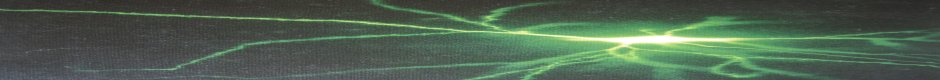Freitag, 20. Mai 2005
Abseitiges
synapse, 15:32h
Flattert mir heute mit der Post eine Werbung ins Haus "Kopp-Verlag". Noch nie gehört, warum kommt das denn zu mir?
Verschwörungstheorien, Okkultes, Abseitiges, Geheimwissen, weniges brauchbar (außer Matrix natürlich) - für mich, eh klar
http://shw.fotopages.com/5569045.html und folgende
Dan Browns Jünger
http://www.wams.de/data/2005/05/22/721564.html
Sachbuch heute: "Leben mit der Suchmaschine"
Die Google-Gesellschaft von Lehmann, Schetsche (siehe Kommentar)
Verschwörungstheorien, Okkultes, Abseitiges, Geheimwissen, weniges brauchbar (außer Matrix natürlich) - für mich, eh klar
http://shw.fotopages.com/5569045.html und folgende
Dan Browns Jünger
http://www.wams.de/data/2005/05/22/721564.html
Sachbuch heute: "Leben mit der Suchmaschine"
Die Google-Gesellschaft von Lehmann, Schetsche (siehe Kommentar)
... comment
synapse,
Freitag, 20. Mai 2005, 15:33
Leben mit der Suchmaschine
Gesammelte Einblicke in die Google-Gesellschaft
Das Wort "googeln" steht schon im Duden. Die Wendung "Ich google dir eine" im bekannten Sinne von "Ich semmel' dir eine" ist nicht geläufig. Googeln ist damit erst einmal eine ganz friedliche Handlung - so, wie "im Katalog nachschlagen" ja auch nicht in der Bedeutung von "im Katalog nachsemmeln" auftritt. Früher, als der lernende Mensch noch vor den Bücherbergen saß und sich auf dem Weg in die ferne Gelehrsamkeit durch diese Massen hindurchlesen mußte, konnte es einem Adepten auf den gut gefüllten und sortierten Kopf passieren, daß er beim Eintritt in eine Klosterbibliothek, die mit alten und meistens in den weitgehend vergessenen Sprachen Latein oder Griechisch geschriebenen Büchern bis an die hohen Decken vollgestopft war, mit den hingehauchten Worten in Ohnmacht fiel: Nicht zu schaffen, das schaffe ich beim besten Willen nicht. Vor Google aber ist noch kein Benutzer, soweit aus der Google-Welt zu erfahren war, in dem bedrückenden, ja vernichtenden Gefühl zusammengebrochen, seine Lebenszeit werde nicht ausreichen, alle Einträge anzuklicken. Das spricht für Google. Das deutet auf eine neue mediale Menschenfreundlichkeit hin. Abgesehen davon, daß googeln in den meisten Fällen wesentlich bequemer ist, als in Katalogen oder dicken Wälzern nachzuschlagen. Das angesammelte Wissen haut heute einen Googler nicht um. Er schaut in die Masse des Wissens, die Google ihm eröffnet, und - klickt.
Google ging im Herbst des letzten Jahres an die Börse. Google beschäftigt dreitausend Mitarbeiter. Google verfügt über einhunderttausend Server. Der Anteil von Google auf dem amerikanischen Markt liegt bei achtundvierzig Prozent, in Deutschland liegt er bei achtzig Prozent. Google ist nicht Gott, sondern eine Suchmaschine. Google ist kein traditionelles Medienunternehmen. Keiner käme heute auf den Gedanken, auf die Straße zu gehen und lauthals zu fordern: Enteignet Google, so, wie vor rund vierzig Jahren junge kritische Gemüter auf die Straße gingen und lauthals "Enteignet Springer" forderten. Damals wurde mir nichts, dir nichts ein kleiner Strukturwandel der Öffentlichkeit inszeniert und eine Gegenöffentlichkeit mit Flugblättern und Broschüren, Diskussionsveranstaltungen und linken Buchläden eröffnet und am Laufen gehalten. Das alles brauchen die Linken heute nicht mehr dringend. Der antikapitalistische Geist organisiert sich im Netz, so, wie ja auch zum Beispiel der Bundeskanzler im Netz steht und um Aufmerksamkeit winkt. Die einen findet man unter http://www.indymedia.org, den anderen unter http://www.bundeskanzler.de.
Das "www" ist heute so etwas wie das Kaufhaus in den deutschen Wirtschaftswunderjahren: Hier konnte man tatsächlich alles finden, was man brauchte. An die Stelle des freundlichen und nur im geheimen sich die Hände reibenden Verkäufers, der einen durch die Welt der Angebote in die gesuchte Abteilung und vor die begehrte Ware führte, ist die freundliche und sich nur im geheimen die Hände reibende Suchmaschine Google getreten. Wer etwas über Google und die Welt mit Google erfahren möchte, kann bei Google nachschauen - oder in dem Buch "Die Google-Gesellschaft" herumlesen. Das Buch ist informativ und bietet Einblick in allerlei Gegenden, die manchen vielleicht nicht geläufig sind: Online-Forschung, Online-Beratung, Online-Journalismus, Foren der Gegenöffentlichkeit, Erläuterungen zum Google-Geschäft, Lernwelten und so weiter. Es gibt eben alles: Blusen, Schuhe, Handwerkerbedarf, Küchengeräte, Sportausrüstung. Für den finanziell potenten Warenkonsumenten war die Eröffnung des Kaufhauses ein einschneidendes seelisches Erlebnis. Die Vorstellung, daß in einem großen Betonkasten alles zu haben war, rumorte in seinem Innern weiter und bereitete den nächsten Besuch vor. Den Googlern ergeht es nicht anders, ein Leben ohne Google wäre kein reiches Leben mehr, wenn Leben denn bedeutet: an der Welt teilzunehmen - indem man sich Wissen über was, wann, wo, wie, wer, womit, wohin, weshalb verschafft.
Ob wir deshalb schon gleich in einer Google-Gesellschaft leben? Erst gab es die Nachkriegsgesellschaft (Schweigen und Zukunft bauen), dann kam die Warengesellschaft (Kapitalismus ist Konsumterror), später die Risikogesellschaft (Wollen wir heiraten?), noch später kam die Erlebnisgesellschaft (Was machen wir denn heute abend?), noch viel später kam die Wissensgesellschaft (Wer nichts weiß, rückt zurück auf Los) und nun - die Google-Gesellschaft (Googler aller Länder, vergoogelt euch). Das ist uns etwas zu vollmundig. Eberhard Rathgeb
Kai Lehmann, Michael Schetsche (Hrsg.): "Die Google-Gesellschaft". Vom digitalen Wandel des Wissens. transcript Verlag, Bielefeld 2005. 408 S., br., 26,80 [Euro].
Text: F.A.Z., 20.05.2005, Nr. 115 / Seite 43
Bildmaterial: AP
Das Wort "googeln" steht schon im Duden. Die Wendung "Ich google dir eine" im bekannten Sinne von "Ich semmel' dir eine" ist nicht geläufig. Googeln ist damit erst einmal eine ganz friedliche Handlung - so, wie "im Katalog nachschlagen" ja auch nicht in der Bedeutung von "im Katalog nachsemmeln" auftritt. Früher, als der lernende Mensch noch vor den Bücherbergen saß und sich auf dem Weg in die ferne Gelehrsamkeit durch diese Massen hindurchlesen mußte, konnte es einem Adepten auf den gut gefüllten und sortierten Kopf passieren, daß er beim Eintritt in eine Klosterbibliothek, die mit alten und meistens in den weitgehend vergessenen Sprachen Latein oder Griechisch geschriebenen Büchern bis an die hohen Decken vollgestopft war, mit den hingehauchten Worten in Ohnmacht fiel: Nicht zu schaffen, das schaffe ich beim besten Willen nicht. Vor Google aber ist noch kein Benutzer, soweit aus der Google-Welt zu erfahren war, in dem bedrückenden, ja vernichtenden Gefühl zusammengebrochen, seine Lebenszeit werde nicht ausreichen, alle Einträge anzuklicken. Das spricht für Google. Das deutet auf eine neue mediale Menschenfreundlichkeit hin. Abgesehen davon, daß googeln in den meisten Fällen wesentlich bequemer ist, als in Katalogen oder dicken Wälzern nachzuschlagen. Das angesammelte Wissen haut heute einen Googler nicht um. Er schaut in die Masse des Wissens, die Google ihm eröffnet, und - klickt.
Google ging im Herbst des letzten Jahres an die Börse. Google beschäftigt dreitausend Mitarbeiter. Google verfügt über einhunderttausend Server. Der Anteil von Google auf dem amerikanischen Markt liegt bei achtundvierzig Prozent, in Deutschland liegt er bei achtzig Prozent. Google ist nicht Gott, sondern eine Suchmaschine. Google ist kein traditionelles Medienunternehmen. Keiner käme heute auf den Gedanken, auf die Straße zu gehen und lauthals zu fordern: Enteignet Google, so, wie vor rund vierzig Jahren junge kritische Gemüter auf die Straße gingen und lauthals "Enteignet Springer" forderten. Damals wurde mir nichts, dir nichts ein kleiner Strukturwandel der Öffentlichkeit inszeniert und eine Gegenöffentlichkeit mit Flugblättern und Broschüren, Diskussionsveranstaltungen und linken Buchläden eröffnet und am Laufen gehalten. Das alles brauchen die Linken heute nicht mehr dringend. Der antikapitalistische Geist organisiert sich im Netz, so, wie ja auch zum Beispiel der Bundeskanzler im Netz steht und um Aufmerksamkeit winkt. Die einen findet man unter http://www.indymedia.org, den anderen unter http://www.bundeskanzler.de.
Das "www" ist heute so etwas wie das Kaufhaus in den deutschen Wirtschaftswunderjahren: Hier konnte man tatsächlich alles finden, was man brauchte. An die Stelle des freundlichen und nur im geheimen sich die Hände reibenden Verkäufers, der einen durch die Welt der Angebote in die gesuchte Abteilung und vor die begehrte Ware führte, ist die freundliche und sich nur im geheimen die Hände reibende Suchmaschine Google getreten. Wer etwas über Google und die Welt mit Google erfahren möchte, kann bei Google nachschauen - oder in dem Buch "Die Google-Gesellschaft" herumlesen. Das Buch ist informativ und bietet Einblick in allerlei Gegenden, die manchen vielleicht nicht geläufig sind: Online-Forschung, Online-Beratung, Online-Journalismus, Foren der Gegenöffentlichkeit, Erläuterungen zum Google-Geschäft, Lernwelten und so weiter. Es gibt eben alles: Blusen, Schuhe, Handwerkerbedarf, Küchengeräte, Sportausrüstung. Für den finanziell potenten Warenkonsumenten war die Eröffnung des Kaufhauses ein einschneidendes seelisches Erlebnis. Die Vorstellung, daß in einem großen Betonkasten alles zu haben war, rumorte in seinem Innern weiter und bereitete den nächsten Besuch vor. Den Googlern ergeht es nicht anders, ein Leben ohne Google wäre kein reiches Leben mehr, wenn Leben denn bedeutet: an der Welt teilzunehmen - indem man sich Wissen über was, wann, wo, wie, wer, womit, wohin, weshalb verschafft.
Ob wir deshalb schon gleich in einer Google-Gesellschaft leben? Erst gab es die Nachkriegsgesellschaft (Schweigen und Zukunft bauen), dann kam die Warengesellschaft (Kapitalismus ist Konsumterror), später die Risikogesellschaft (Wollen wir heiraten?), noch später kam die Erlebnisgesellschaft (Was machen wir denn heute abend?), noch viel später kam die Wissensgesellschaft (Wer nichts weiß, rückt zurück auf Los) und nun - die Google-Gesellschaft (Googler aller Länder, vergoogelt euch). Das ist uns etwas zu vollmundig. Eberhard Rathgeb
Kai Lehmann, Michael Schetsche (Hrsg.): "Die Google-Gesellschaft". Vom digitalen Wandel des Wissens. transcript Verlag, Bielefeld 2005. 408 S., br., 26,80 [Euro].
Text: F.A.Z., 20.05.2005, Nr. 115 / Seite 43
Bildmaterial: AP
... link
... comment
mark793,
Freitag, 20. Mai 2005, 15:42
Ah, von Google
sprachen wir auch grade drüben beim Herrn Leteil...
... link
... comment
synapse,
Sonntag, 29. Mai 2005, 18:35
Fragen Sie nach Risiken und Nebenwirkungen
Wir feiern die Wissensgesellschaft, doch hinter diesem Wort steht ein Phänomen - keine Idee und erst recht keine Verheißung
Überall wird geforscht. Wissenschaft ist längst nicht mehr nur eine Domäne der Labors. Auch in Politik, Medien und Privathaushalten verläßt sich kaum noch jemand nur auf seinen Instinkt oder seine Lebenserfahrung. Statt dessen wollen alle ihre Entscheidung durch theoriegeleitete Empirie oder empiriegeleitete Theorie abgesichert sehen. Also werden in einem fort Sachverständige befragt, Waren getestet, Gutachten be- und erstellt, Umfragen durchgeführt und zitiert, wird Ratgeberliteratur verfaßt und gelesen.
Das Phänomen hat einen Namen und der ist "Wissensgesellschaft". Wir befinden uns auf dem Weg in die Wissensgesellschaft, heißt es, werden demnächst ankommen oder sind schon da. Was ist damit gemeint? Daß Wissen ein integraler Bestandteil der Gesellschaft ist, gilt, seit der Mensch Wissen an seinesgleichen weitergeben kann. Die so verstandene Wissensgesellschaft begann spätestens in der Altsteinzeit. Daß die Wissenschaft, zumal die Naturwissenschaft, unser Leben immer mehr verändert, ist auch keine ganz neue Entwicklung mehr. Vergleichsweise neu ist dagegen, daß "das Prinzip der For-schung, des hypothetischen und experimentellen, lernenden Umgangs mit Information, in der Gesellschaft zum allgemeinen Handlungsmodus" wird, wie der Bielefelder Soziologe Peter Weingart den Trend einmal zusammengefaßt hat. Was eine Wissensgesellschaft auszeichnet, ist also nicht der Umstand, daß sie mehr als andere Gesellschaften von Wissen bestimmt würde, sondern die Art und Weise, wie sie einen dominanten Teil ihres Wissens erzeugt und absichert: durch Forschung nach dem Vorbild der neuzeitlichen Wissenschaft.
Dabei hat die Vokabel einen verheißungsvollen Klang. Zuweilen wird "Wissensgesellschaft" geradezu als Gegenbegriff zu einer als defizitär empfundenen "Informationsgesellschaft" verwendet. Doch "Wissensgesellschaft" ist eben keine Idee, sondern ein soziales Phänomen - noch dazu eines, das sich durch seine Ambivalenz neue Probleme schafft. Da ist etwa jener Umstand, den Weingart in seinem vor vier Jahren erschienenen Buch "Die Stunde der Wahrheit" den "Distanzverlust" der Wissenschaft zu anderen sozialen Sektoren genannt hat. So greifen etwa Politiker in wachsendem Umfang auf wissenschaftliche Expertisen zurück, um damit ihre Entscheidungen abzusichern. Die Wissenschaftler werden dabei leicht in politische Grabenkämpfe hineingezogen, vor allem dort, wo die Sachlage auch wissenschaftlich ungeklärt ist, etwa bei der grünen Gentechnik. Von außen sind politische und wissenschaftliche Kontroversen bald kaum noch zu trennen - mit unguten Folgen für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft und damit auch für die Politik, die diese Glaubwürdigkeit ja gerade legitimieren soll.
Neben solcher Politisierung der Wissenschaft haben wir es, wie Weingart glaubt, außerdem mit einer zunehmenden Kommerzialisierung und Medialisierung der Wissenschaft zu tun. Durch die Kommerzialisierung wird Wissen zur Ware und unterliegt ökonomischen Produktionsbedingungen. Auch die Darstellung der Wissenschaft in den Medien wirkt auf die Forschung zurück, mitunter bis in die Auswahl der Forschungsgegenstände hinein. Dabei richtet sich die mediale Beachtung eines Forschungsergebnisses auch, und nicht selten entscheidend, nach außerwissenschaftlichen Kriterien: eine gruselige Gletschermumie kommt eher ins Fernsehen als ein archäologisch vielleicht viel bedeutenderer Keramikfund, ein bunter kosmischer Nebel eher als eine neue Erkenntnis in der Festkörperphysik. Vor allem aber wird die öffentliche Wahrnehmung des Wissenschaftsgeschehens stark von der tatsächlichen oder vermeintlichen Relevanz neuer Erkenntnisse für verbreitete lebensweltliche Probleme gesteuert: Ein Zeitungsartikel über eine erfolgversprechende neue Tumortherapie findet hierzulande, wo Krebs die zweithäufigste Todesursache ist, mehr Aufmerksamkeit als einer über die Bekämpfung von Malaria, eine der häufigsten Todesursachen in Afrika.
Das Dilemma der
Nichtwissensgesellschaft
Gerecht ist das alles nicht, weder gegenüber den Forschern noch ihren Gegenständen. Und mit dem Ideal einer "Freiheit der Wissenschaft" ist es auch nicht unbedingt vereinbar. Doch wenn nicht alles täuscht, handelt es sich dabei gerade nicht um Fehlentwicklungen der Wissensgesellschaft, sondern um deren unausweichliche Begleiterscheinungen. Wo Wissensproduktion eine gesellschaftliche Angelegenheit ist, läßt es sich nicht verhindern, daß sie gesellschaftlichen Zwängen und Vorgaben folgt. Wenn Politiker wissenschaftlich informiert entscheiden sollen, dann wird Wissen eben politisch; wenn neues Wissen bessere Güter und Dienstleistungen ermöglicht, wird es eben zur Ware, und wenn wissenschaftliche Ergebnisse etwas sind, was jeden angeht, dann werden sie eben Gegenstand der Medien.
Tatsächlich gibt es Entwicklungen, die einem Gemeinwesen, das eine Wissensgesellschaft sein will, auf lange Sicht mehr zu schaffen machen dürften als der Weingartsche Distanzverlust. Eine hat mit dem Umstand zu tun, daß die Zunahme des Wissens auch massenhaft Nichtwissen in die Welt setzt. Gemeint sind nicht die neuen Fragen die jede Entdeckung gewöhnlich aufwirft; gemeint ist jenes Nichtwissen, das Abschätzung und Abwägen von Risiken erfordert.
Nun könnte man denken, in einer Gesellschaft, die unablässig neue Informationen produziert, sollten die Risiken auch immer besser kalkulierbar werden. Doch aus drei Gründen ist genau das Gegenteil der Fall: Erstens führt mehr Information nur dann zu einer besseren Kalkulierbarkeit eines Risikos, wenn sie denselben Gegenstand betreffen, sagen wir die Nebenwirkungen eines bestimmten Medikaments. Eine Pharmaindustrie, die ständig neue Medikamente entwickelt, muß aber mit dem Sammeln an Erfahrungen über Nebenwirkungen bei jedem einzelnen Präparat wieder fast von vorne anfangen. Was bei Medikamenten durch Tierversuche und klinische Studien noch einigermaßen machbar ist, stößt bei anderen Technologien schnell an ökonomische Grenzen. Von einem neuen Flugzeugtyp kann man nicht Hunderte von Exemplaren jahrelang nur versuchsweise umherfliegen lassen, bevor man sie für den Verkehr freigibt. Auch ein Kernkraftwerk sollte tunlichst gleich nach der Fertigstellung sicher laufen. Hier kann die Schadenswahrscheinlichkeit überhaupt nicht empirisch, sondern nur durch sogenannte Risikoanalysen ermittelt werden, bei denen sich Techniker vorstellen, was alles passieren könnte. Es liegt auf der Hand, daß dabei um so mehr unbekannte Wirkungszusammenhänge übersehen werden, je neuer die Technologie ist. Nimmt man dann noch die immer kürzeren Innovationszyklen und die steigende Komplexität potentiell riskanten Wissens hinzu, muß man feststellen, daß die Abschätzung von Risiken in einer Wissensgesellschaft immer schwieriger wird.
Zweitens sind bei neuen Technologien auch die Schadenshöhen immer schwerer abzuschätzen. Ein Flugzeugabsturz ist versicherungstechnisch noch eine überschaubare Angelegenheit. Doch wie soll man den Schaden durch eine nukleare Havarie mit Austritt radioaktiver Substanzen beziffern, die noch nach Jahrzehnten das Krebsrisiko kontaminierter Personen erhöhen? Bis heute streiten sich die Experten, wie hoch nun der Schaden war, der 1986 durch den geborstenen Reaktor von Tschernobyl entstand. Und nicht wenige halten es für zynisch, das Leid krebskranker Kinder überhaupt in Dollar und Euro messen zu wollen.
Dabei ist die Kernenergie zumindest so lange bekannt, daß man im Prinzip weiß, welche Folgen ein schwerer Unfall haben kann - wenn auch wieder nur durch Hochrechnung leidvoller Erfahrungen der Vergangenheit. So birgt - und das ist der dritte Grund für die wachsende Unkalkulierbarkeit von Risiken in der Wissensgesellschaft - jede neue Technologie möglicherweise Grundrisiken, von denen wir gar nichts wissen können. Im vorhinein können wir sie oft allenfalls begründet imaginieren, etwa im Falle gentechnisch veränderter Nahrungsmittelpflanzen. Obwohl noch niemand durch genmanipulierte Mais- oder Sojaprodukte zu Schaden gekommen ist, können wir uns doch Gefahrenszenarien ausmalen und damit gegen die Einführung der entsprechenden Technologien argumentieren; begründet und engagiert, aber weitgehend empiriefrei. Spätestens in solchen Debatten zeigt sich: das zur Risikoabschätzung nötige Wissen kann in vielen Fällen selber nicht mehr wissenschaftlich abgesichert werden.
Die Wissensgesellschaft ist also immer auch eine Nichtwissensgesellschaft, deren Dilemma darin besteht, einerseits nicht warten zu können, bis sich etwas als garantiert ungefährlich erwiesen hat. Sie kann andererseits aber auch nicht auf alles kurzerhand verzichten, was zu einer Risikovermutung Anlaß gibt. Wer hätte das Recht, darüber zu entscheiden, wenn die Experten nur mit den Schultern zucken? Immer gibt es jemanden, der von einer neuen Technologie profitiert - im Falle der grünen Gentechnik sind es nicht nur die Saatgutproduzenten, sondern auch Sojabauern in Paraguay, denen die Gentechnik schöne Ertragssteigerungen beschert. Sich diesen Vorteil zu sichern ist, solange keine Gefahren aktenkundig geworden sind, ihr gutes Recht, wie es auch das Recht der europäischen Verbraucher ist, prophylaktisch keine Gensoja zu essen und deswegen eine Kennzeichnungspflicht zu fordern. Keine der beiden Seiten sollte sich jedoch einbilden, hier eine wissensbasierte Diskussion zu führen.
Schon auf einer sehr praktischen Ebene lassen sich also lange nicht alle Entscheidungen wissenschaftlich absichern. Daher irrt, wer glaubt, anderes als solchermaßen abzusicherndes Wissen spiele in einer Wissensgesellschaft keine Rolle mehr. Im Gegenteil, es spielt eine Rolle, nicht zuletzt bei ethischen Urteilen. Es gibt nun einmal sehr grundsätzliche Aussagen über die Welt, und dazu gehören ethische Normen, deren Gültigkeit nicht wissenschaftlich abgesichert werden kann. Die Vorstellung, der wissenschaftliche Fortschritt mache die Welt für den Menschen nicht nur komfortabler, sondern auch im moralischen Sinne besser, ist eine Illusion.
Die unüberbrückbare Kluft
zwischen Wissen und Werten
Die fehlende wissenschaftliche Absicherung von Werturteilen bedeutet natürlich nicht, daß man nichts mehr zu wissen brauche, sobald die Sphäre des Ethischen berührt ist. Ganz im Gegenteil. Gerade die Wertfragen, die der wissenschaftlich-technische Fortschritt überhaupt erst aufwirft, lassen sich nur diskutieren, wenn man auch sachlich Bescheid weiß. Wenn etwa um die Frage gestritten wird, ob man eine künstliche Befruchtung durchführen darf, um dabei die Embryonen nach genetischen Dispositionen zu selektieren, dann sollten die Kontrahenten die zugrundeliegende Biologie schon kennen. Nur darf das eben nicht dazu führen, daß deswegen den Fortpflanzungsmedizinern, also den Experten für das Sein, auch erhöhte Kompetenz für das Sollen zugestanden wird. Ihrer Urteilsfähigkeit ist hier sogar eher zu mißtrauen. Denn gerade die Experten haben nicht selten auch ein außerwissenschaftliches (berufliches oder materielles) Interesse daran, daß ihre Expertise praktisch genutzt wird. Diesen Umstand kann man nicht ändern und braucht ihn auch nicht zu bedauern - er gehört einfach zu den Bedingungen, unter denen wissenschaftlicher Fortschritt stattfindet. Wichtig ist, sich dieser Bedingungen bewußt zu bleiben und Hinweise auf solche Zusammenhänge nicht als Wissenschaftsfeindlichkeit auszulegen. Die Wissensgesellschaft produziert nun einmal von selber keine Werte, am wenigsten ist sie ein Wert an sich. Eine Wissensgesellschaft, in der nicht auch ihre eigenen Bedingungen thematisiert würden, liefe in der Tat Gefahr, irgendwann zu jener düsteren Welt zu verkümmern, die Zivilisationskritiker immer schon an die Wand malen.
Möglicherweise wäre es dann aber auch mit der Wissenschaft bald vorbei. Die Wissensgesellschaft jedenfalls, die wir heute auf dem Weg sehen, bildet sich unter den Bedingungen einer kapitalistisch organisierten, demokratisch verfaßten und zugleich von jahrtausendealten individualethischen Werten geprägten Öffentlichkeit. Daher ließe sich spekulieren, inwiefern dieser Gesellschaftstyp nicht konstitutiv für die Wissensgesellschaft ist und sein wie immer geartetes Ende nicht auch deren Untergang nach sich ziehen müßte. Es ist ja durchaus fraglich, ob technikbasierte und zugleich totalitäre Gemeinwesen, die Romane wie "1984" oder "Brave New World" schildern, in der Wirklichkeit dauerhaft bestehen könnten. Die sozio-ökonomischen Mechanismen der Innovation würden in solchen Gesellschaften wohl kaum so ablaufen, wie wir sie derzeit am Werke sehen. Bei technisierten Ameisenstaaten vom Schlage der "Borg" aus den Star-Trek-Filmen oder den Roboter-Gesellschaften, von denen manche Enthusiasten der Künstlichen Intelligenz träumen, sind noch mehr Zweifel angebracht.
Es ist vielleicht kein Zufall, daß solche Visionen ihre Wurzeln in einer Zeit haben, in welcher der Trend zur Wissensgesellschaft bereits unverkennbar war (wenn auch noch nicht unter dieser Vokabel), man aber noch selbstverständlich davon ausging, die Gesellschaft würde sich dem Wissen anpassen, nicht aber umgekehrt. Gerade davon kann aber heute nicht mehr ernsthaft die Rede sein. Der von Weingart diagnostizierte Schwund der Distanz zwischen Wissenschaft und anderen sozialen Sektoren läßt die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wissenschaftliches Wissen gewonnen und angewandt wird, immer deutlicher werden. Im gleichen Maße kommt man heute auch von der Überzeugung ab, wissenschaftlich-technische Lösungen seien allem Natürlichen oder Traditionellen eo ipso überlegen. So sind etwa die Zeiten vorbei, in denen Müttern das Stillen mit dem Hinweis ausgeredet wurde, das sei doch angesichts moderner Milchpulvertechnologie nicht mehr nötig.
Insofern kann man den Distanzschwund auch positiv bewerten. Gerade dadurch könnte sich die Wissensgesellschaft ihre von wissenschaftsexternen Grundwerten geleitete freiheitlich-demokratische Basis sichern und damit womöglich auf lange Sicht selbst stabilisieren. Ihr großes Problem dabei bleibt, daß sie bei der Reflexion auf ihre eigenen Bedingungen auf einen ihr wesensfremden Typ von Wissen zurückgreifen muß und daß zur Hervorbringung dieses Wissens immer wieder Fragen beantwortet werden müssen, die sich der Wissenschaft letztlich entziehen.
Die Verdrängung oder Leugnung dieses inhärenten, unaufhebbaren Defizites der Wissensgesellschaft ist vielleicht einer der Gründe dafür, warum manche Zeitgenosssen sich zur Wissensgesellschaft in einer Weise verhalten, die angesichts ihrer Errungenschaften seltsam anmuten muß.
Drei dieser Haltungen lassen sich unterscheiden. Die erste könnte man als "romantische Verweigerung" bezeichnen. Romantische Verweigerer versuchen das als entfremdend wahrgenommene Fortschreiten des Wissens aufzuhalten, und nicht selten setzen sie der Wissensgesellschaft ein vereinfachtes und verklärtes Bild einer vermeintlich besseren Vergangenheit ohne die Dominanz von Technik und Wissenschaft entgegen. Die meisten romantischen Verweigerer schaden der Wissensgesellschaft aber höchstens dadurch, daß sie sich und ihre Fähigkeiten von ihr fernhalten. Andererseits kann ihre Kritik durchaus nützen. Auch ist der Grad der Verweigerung sehr unterschiedlich. Es gibt keine wirklich scharfe Grenze zwischen denen, die sich wirklich verweigern, und denen, die es lediglich an Enthusiasmus für die Wissensgesellschaft fehlen lassen und auf ihre Probleme, darunter die hier bedachten, aufmerksam machen wollen.
Verweigerung, Ignoranzkult
und das Elend der Esoterik
Romantische Verweigerer findet man in der Regel eher unter den intellektuell Aktiveren. Am anderen Ende des gesellschaftlichen Spektrums dominiert ein ganz anderer Typ von Rebellion gegen die Wissensgesellschaft. Man könnte ihn als "Kult der Ignoranz" bezeichnen. Er äußert sich, salopp gesagt, in einer Verachtung von Wissen als "uncool". Sichtbar geworden ist der Ignoranz-Kult vor allem als Medienphänomen. Man erinnere sich nur an den "Big Brother"-Star Zlatko, der seine Popularität Bekenntnissen verdankt wie dem, nicht zu wissen, wer Shakespeare sei. Und mit Verona Feldbusch trat ein Mediengeschöpf vor die Kameras, dessen vorgespielte Mängel in grundlegenden Wissenstechniken einen Teil ihres öffentlichen Bildes ausmachten. Obwohl solche Phänomene sicher auch noch andere Gründe haben, lassen sie sich unschwer als Reaktion von Menschen auf Überforderungen durch die Wissensgesellschaft interpretieren: Die tumben Stars kommen deshalb gut an, weil sie die entlastende Illusion erzeugen, gesellschaftliches Ansehen lasse sich auch für den erreichen, der den Anforderungen der Wissensgesellschaft nicht gewachsen ist. Die Gefahren liegen auf der Hand: Die Menschen werden vom Wissen ferngehalten, ohne daß es ihnen erlaubt wäre, aus der Wissensgesellschaft auszusteigen. Ihre Entfremdungssymptome werden nur übertüncht. Vor allem aber: Sie sind als Wähler wie als Verbraucher den Manipulationen derer ausgeliefert, die längst erkannt haben, daß man auch Werbung wissenschaftlich perfektionieren kann.
Eine dritte Art der Reaktion gegen die Wissensgesellschaft ist die sogenannte Esoterik. Dieser schillernde, in seinem Gebrauch ziemlich variable Begriff soll hier vom Schamanenwissen bis zur Bachblütentherapie all jenes Wissen über die sichtbare Welt zusammenfassen, bei dem es nach akademisch anerkannten Standards an der Begründbarkeit hapert. Interessanterweise sind esoterische Neigungen in allen gesellschaftlichen Schichten anzutreffen - auch unter Akademikern. Das hat sicher auch damit zu tun, daß es sich bei der Esoterik um ein soziales Phänomen handelt, das entschieden im Gewande der Wissenschaft auftritt. In ihren para- und pseudowissenschaftlichen Formen unterscheidet sie sich von orthodoxer Wissenschaft oft nur in subtilen (aber letztlich entscheidenden) methodischen Details.
Esoterik ist gerade dort attraktiv, wo die orthodoxe Wissenschaft den Wissensbedarf der Menschen eben nicht decken kann - ob das nun Fragen individuellen Handelns betrifft oder die Dilemmata der Nichtwissensgesellschaft. Statt diese Unsicherheit und Unabsicherbarkeit auszuhalten und traditionelle, dezidiert nichtwissenschaftliche Maßnahmen - etwa Gebete - zu bemühen, wünschen sich die Esoteriker eine Wissenschaft herbei, die ihnen in allen Lebenslagen durch forschungsförmige Aktivitäten abgesicherten Rat erteilt, ob es nun um magnetische Wasserentkal-kung, sanfte Krebsheilung oder astrologisch unterstützte Partnerwahl geht. Esoterik ist also gerade kein Ausdruck einer Verachtung der Wissensgesellschaft, sondern im Gegenteil Ausdruck ihrer zuweilen maßlosen Überschätzung.
Von den skizzierten Reaktionstypen auf die Defizite der Wissensgesellschaft ist die Esoterik vielleicht der problematischste. Denn erstens werden auch die Konsumenten esoterischen Wissens leicht Opfer von Manipulationen wirtschaftlich interessierter Kreise, von Scharlatanen und Quacksalbern. Hinzu kommt, daß Esoterik die Probleme der Wissensgesellschaft nicht nur nicht löst, sondern ihre Errungenschaften regelrecht zunichte machen kann. So gibt es Mütter, die sich auf Anraten obskurer Homöopathen weigern, ihren Babys im ersten Lebensjahr zusätzlich Vitamin D zu geben, und so riskieren, daß die Kinder Rachitis bekommen.
Die ethischen Normen, die Esoteriker ihren jeweiligen Lehren zuweilen auch entnehmen, sind natürlich genausowenig durch Forschung absicherbar wie die traditionellen Normen auch. Dennoch gerieren sie sich als methodisch gesichertes Wissen. Konsequent esoterische Fraktionen der Wissensgesellschaft sind daher nicht mehr in der Lage, die Probleme überhaupt zu erkennen. Ihr Weltbild ist wissenschaftsförmig - und kann sich daher modern vorkommen - und ist zugleich so geschlossen wie in magischen Kulturen. Auch deshalb ist Esoterik am Ende sogar gefährlicher als Ignoranz oder Verweigerung: weil sie ihren Adepten eine Harmonie zwischen Wissen und Werten vorgaukelt, die es nicht gibt.
In der kommenden Woche erscheint Ulf von Rauchhaupts Buch "Wittgensteins Klarinette. Gegenwart und Zukunft des Wissens".
Text: F.A.Z., 28.05.2005, Nr. 121 / Seite 39
Überall wird geforscht. Wissenschaft ist längst nicht mehr nur eine Domäne der Labors. Auch in Politik, Medien und Privathaushalten verläßt sich kaum noch jemand nur auf seinen Instinkt oder seine Lebenserfahrung. Statt dessen wollen alle ihre Entscheidung durch theoriegeleitete Empirie oder empiriegeleitete Theorie abgesichert sehen. Also werden in einem fort Sachverständige befragt, Waren getestet, Gutachten be- und erstellt, Umfragen durchgeführt und zitiert, wird Ratgeberliteratur verfaßt und gelesen.
Das Phänomen hat einen Namen und der ist "Wissensgesellschaft". Wir befinden uns auf dem Weg in die Wissensgesellschaft, heißt es, werden demnächst ankommen oder sind schon da. Was ist damit gemeint? Daß Wissen ein integraler Bestandteil der Gesellschaft ist, gilt, seit der Mensch Wissen an seinesgleichen weitergeben kann. Die so verstandene Wissensgesellschaft begann spätestens in der Altsteinzeit. Daß die Wissenschaft, zumal die Naturwissenschaft, unser Leben immer mehr verändert, ist auch keine ganz neue Entwicklung mehr. Vergleichsweise neu ist dagegen, daß "das Prinzip der For-schung, des hypothetischen und experimentellen, lernenden Umgangs mit Information, in der Gesellschaft zum allgemeinen Handlungsmodus" wird, wie der Bielefelder Soziologe Peter Weingart den Trend einmal zusammengefaßt hat. Was eine Wissensgesellschaft auszeichnet, ist also nicht der Umstand, daß sie mehr als andere Gesellschaften von Wissen bestimmt würde, sondern die Art und Weise, wie sie einen dominanten Teil ihres Wissens erzeugt und absichert: durch Forschung nach dem Vorbild der neuzeitlichen Wissenschaft.
Dabei hat die Vokabel einen verheißungsvollen Klang. Zuweilen wird "Wissensgesellschaft" geradezu als Gegenbegriff zu einer als defizitär empfundenen "Informationsgesellschaft" verwendet. Doch "Wissensgesellschaft" ist eben keine Idee, sondern ein soziales Phänomen - noch dazu eines, das sich durch seine Ambivalenz neue Probleme schafft. Da ist etwa jener Umstand, den Weingart in seinem vor vier Jahren erschienenen Buch "Die Stunde der Wahrheit" den "Distanzverlust" der Wissenschaft zu anderen sozialen Sektoren genannt hat. So greifen etwa Politiker in wachsendem Umfang auf wissenschaftliche Expertisen zurück, um damit ihre Entscheidungen abzusichern. Die Wissenschaftler werden dabei leicht in politische Grabenkämpfe hineingezogen, vor allem dort, wo die Sachlage auch wissenschaftlich ungeklärt ist, etwa bei der grünen Gentechnik. Von außen sind politische und wissenschaftliche Kontroversen bald kaum noch zu trennen - mit unguten Folgen für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft und damit auch für die Politik, die diese Glaubwürdigkeit ja gerade legitimieren soll.
Neben solcher Politisierung der Wissenschaft haben wir es, wie Weingart glaubt, außerdem mit einer zunehmenden Kommerzialisierung und Medialisierung der Wissenschaft zu tun. Durch die Kommerzialisierung wird Wissen zur Ware und unterliegt ökonomischen Produktionsbedingungen. Auch die Darstellung der Wissenschaft in den Medien wirkt auf die Forschung zurück, mitunter bis in die Auswahl der Forschungsgegenstände hinein. Dabei richtet sich die mediale Beachtung eines Forschungsergebnisses auch, und nicht selten entscheidend, nach außerwissenschaftlichen Kriterien: eine gruselige Gletschermumie kommt eher ins Fernsehen als ein archäologisch vielleicht viel bedeutenderer Keramikfund, ein bunter kosmischer Nebel eher als eine neue Erkenntnis in der Festkörperphysik. Vor allem aber wird die öffentliche Wahrnehmung des Wissenschaftsgeschehens stark von der tatsächlichen oder vermeintlichen Relevanz neuer Erkenntnisse für verbreitete lebensweltliche Probleme gesteuert: Ein Zeitungsartikel über eine erfolgversprechende neue Tumortherapie findet hierzulande, wo Krebs die zweithäufigste Todesursache ist, mehr Aufmerksamkeit als einer über die Bekämpfung von Malaria, eine der häufigsten Todesursachen in Afrika.
Das Dilemma der
Nichtwissensgesellschaft
Gerecht ist das alles nicht, weder gegenüber den Forschern noch ihren Gegenständen. Und mit dem Ideal einer "Freiheit der Wissenschaft" ist es auch nicht unbedingt vereinbar. Doch wenn nicht alles täuscht, handelt es sich dabei gerade nicht um Fehlentwicklungen der Wissensgesellschaft, sondern um deren unausweichliche Begleiterscheinungen. Wo Wissensproduktion eine gesellschaftliche Angelegenheit ist, läßt es sich nicht verhindern, daß sie gesellschaftlichen Zwängen und Vorgaben folgt. Wenn Politiker wissenschaftlich informiert entscheiden sollen, dann wird Wissen eben politisch; wenn neues Wissen bessere Güter und Dienstleistungen ermöglicht, wird es eben zur Ware, und wenn wissenschaftliche Ergebnisse etwas sind, was jeden angeht, dann werden sie eben Gegenstand der Medien.
Tatsächlich gibt es Entwicklungen, die einem Gemeinwesen, das eine Wissensgesellschaft sein will, auf lange Sicht mehr zu schaffen machen dürften als der Weingartsche Distanzverlust. Eine hat mit dem Umstand zu tun, daß die Zunahme des Wissens auch massenhaft Nichtwissen in die Welt setzt. Gemeint sind nicht die neuen Fragen die jede Entdeckung gewöhnlich aufwirft; gemeint ist jenes Nichtwissen, das Abschätzung und Abwägen von Risiken erfordert.
Nun könnte man denken, in einer Gesellschaft, die unablässig neue Informationen produziert, sollten die Risiken auch immer besser kalkulierbar werden. Doch aus drei Gründen ist genau das Gegenteil der Fall: Erstens führt mehr Information nur dann zu einer besseren Kalkulierbarkeit eines Risikos, wenn sie denselben Gegenstand betreffen, sagen wir die Nebenwirkungen eines bestimmten Medikaments. Eine Pharmaindustrie, die ständig neue Medikamente entwickelt, muß aber mit dem Sammeln an Erfahrungen über Nebenwirkungen bei jedem einzelnen Präparat wieder fast von vorne anfangen. Was bei Medikamenten durch Tierversuche und klinische Studien noch einigermaßen machbar ist, stößt bei anderen Technologien schnell an ökonomische Grenzen. Von einem neuen Flugzeugtyp kann man nicht Hunderte von Exemplaren jahrelang nur versuchsweise umherfliegen lassen, bevor man sie für den Verkehr freigibt. Auch ein Kernkraftwerk sollte tunlichst gleich nach der Fertigstellung sicher laufen. Hier kann die Schadenswahrscheinlichkeit überhaupt nicht empirisch, sondern nur durch sogenannte Risikoanalysen ermittelt werden, bei denen sich Techniker vorstellen, was alles passieren könnte. Es liegt auf der Hand, daß dabei um so mehr unbekannte Wirkungszusammenhänge übersehen werden, je neuer die Technologie ist. Nimmt man dann noch die immer kürzeren Innovationszyklen und die steigende Komplexität potentiell riskanten Wissens hinzu, muß man feststellen, daß die Abschätzung von Risiken in einer Wissensgesellschaft immer schwieriger wird.
Zweitens sind bei neuen Technologien auch die Schadenshöhen immer schwerer abzuschätzen. Ein Flugzeugabsturz ist versicherungstechnisch noch eine überschaubare Angelegenheit. Doch wie soll man den Schaden durch eine nukleare Havarie mit Austritt radioaktiver Substanzen beziffern, die noch nach Jahrzehnten das Krebsrisiko kontaminierter Personen erhöhen? Bis heute streiten sich die Experten, wie hoch nun der Schaden war, der 1986 durch den geborstenen Reaktor von Tschernobyl entstand. Und nicht wenige halten es für zynisch, das Leid krebskranker Kinder überhaupt in Dollar und Euro messen zu wollen.
Dabei ist die Kernenergie zumindest so lange bekannt, daß man im Prinzip weiß, welche Folgen ein schwerer Unfall haben kann - wenn auch wieder nur durch Hochrechnung leidvoller Erfahrungen der Vergangenheit. So birgt - und das ist der dritte Grund für die wachsende Unkalkulierbarkeit von Risiken in der Wissensgesellschaft - jede neue Technologie möglicherweise Grundrisiken, von denen wir gar nichts wissen können. Im vorhinein können wir sie oft allenfalls begründet imaginieren, etwa im Falle gentechnisch veränderter Nahrungsmittelpflanzen. Obwohl noch niemand durch genmanipulierte Mais- oder Sojaprodukte zu Schaden gekommen ist, können wir uns doch Gefahrenszenarien ausmalen und damit gegen die Einführung der entsprechenden Technologien argumentieren; begründet und engagiert, aber weitgehend empiriefrei. Spätestens in solchen Debatten zeigt sich: das zur Risikoabschätzung nötige Wissen kann in vielen Fällen selber nicht mehr wissenschaftlich abgesichert werden.
Die Wissensgesellschaft ist also immer auch eine Nichtwissensgesellschaft, deren Dilemma darin besteht, einerseits nicht warten zu können, bis sich etwas als garantiert ungefährlich erwiesen hat. Sie kann andererseits aber auch nicht auf alles kurzerhand verzichten, was zu einer Risikovermutung Anlaß gibt. Wer hätte das Recht, darüber zu entscheiden, wenn die Experten nur mit den Schultern zucken? Immer gibt es jemanden, der von einer neuen Technologie profitiert - im Falle der grünen Gentechnik sind es nicht nur die Saatgutproduzenten, sondern auch Sojabauern in Paraguay, denen die Gentechnik schöne Ertragssteigerungen beschert. Sich diesen Vorteil zu sichern ist, solange keine Gefahren aktenkundig geworden sind, ihr gutes Recht, wie es auch das Recht der europäischen Verbraucher ist, prophylaktisch keine Gensoja zu essen und deswegen eine Kennzeichnungspflicht zu fordern. Keine der beiden Seiten sollte sich jedoch einbilden, hier eine wissensbasierte Diskussion zu führen.
Schon auf einer sehr praktischen Ebene lassen sich also lange nicht alle Entscheidungen wissenschaftlich absichern. Daher irrt, wer glaubt, anderes als solchermaßen abzusicherndes Wissen spiele in einer Wissensgesellschaft keine Rolle mehr. Im Gegenteil, es spielt eine Rolle, nicht zuletzt bei ethischen Urteilen. Es gibt nun einmal sehr grundsätzliche Aussagen über die Welt, und dazu gehören ethische Normen, deren Gültigkeit nicht wissenschaftlich abgesichert werden kann. Die Vorstellung, der wissenschaftliche Fortschritt mache die Welt für den Menschen nicht nur komfortabler, sondern auch im moralischen Sinne besser, ist eine Illusion.
Die unüberbrückbare Kluft
zwischen Wissen und Werten
Die fehlende wissenschaftliche Absicherung von Werturteilen bedeutet natürlich nicht, daß man nichts mehr zu wissen brauche, sobald die Sphäre des Ethischen berührt ist. Ganz im Gegenteil. Gerade die Wertfragen, die der wissenschaftlich-technische Fortschritt überhaupt erst aufwirft, lassen sich nur diskutieren, wenn man auch sachlich Bescheid weiß. Wenn etwa um die Frage gestritten wird, ob man eine künstliche Befruchtung durchführen darf, um dabei die Embryonen nach genetischen Dispositionen zu selektieren, dann sollten die Kontrahenten die zugrundeliegende Biologie schon kennen. Nur darf das eben nicht dazu führen, daß deswegen den Fortpflanzungsmedizinern, also den Experten für das Sein, auch erhöhte Kompetenz für das Sollen zugestanden wird. Ihrer Urteilsfähigkeit ist hier sogar eher zu mißtrauen. Denn gerade die Experten haben nicht selten auch ein außerwissenschaftliches (berufliches oder materielles) Interesse daran, daß ihre Expertise praktisch genutzt wird. Diesen Umstand kann man nicht ändern und braucht ihn auch nicht zu bedauern - er gehört einfach zu den Bedingungen, unter denen wissenschaftlicher Fortschritt stattfindet. Wichtig ist, sich dieser Bedingungen bewußt zu bleiben und Hinweise auf solche Zusammenhänge nicht als Wissenschaftsfeindlichkeit auszulegen. Die Wissensgesellschaft produziert nun einmal von selber keine Werte, am wenigsten ist sie ein Wert an sich. Eine Wissensgesellschaft, in der nicht auch ihre eigenen Bedingungen thematisiert würden, liefe in der Tat Gefahr, irgendwann zu jener düsteren Welt zu verkümmern, die Zivilisationskritiker immer schon an die Wand malen.
Möglicherweise wäre es dann aber auch mit der Wissenschaft bald vorbei. Die Wissensgesellschaft jedenfalls, die wir heute auf dem Weg sehen, bildet sich unter den Bedingungen einer kapitalistisch organisierten, demokratisch verfaßten und zugleich von jahrtausendealten individualethischen Werten geprägten Öffentlichkeit. Daher ließe sich spekulieren, inwiefern dieser Gesellschaftstyp nicht konstitutiv für die Wissensgesellschaft ist und sein wie immer geartetes Ende nicht auch deren Untergang nach sich ziehen müßte. Es ist ja durchaus fraglich, ob technikbasierte und zugleich totalitäre Gemeinwesen, die Romane wie "1984" oder "Brave New World" schildern, in der Wirklichkeit dauerhaft bestehen könnten. Die sozio-ökonomischen Mechanismen der Innovation würden in solchen Gesellschaften wohl kaum so ablaufen, wie wir sie derzeit am Werke sehen. Bei technisierten Ameisenstaaten vom Schlage der "Borg" aus den Star-Trek-Filmen oder den Roboter-Gesellschaften, von denen manche Enthusiasten der Künstlichen Intelligenz träumen, sind noch mehr Zweifel angebracht.
Es ist vielleicht kein Zufall, daß solche Visionen ihre Wurzeln in einer Zeit haben, in welcher der Trend zur Wissensgesellschaft bereits unverkennbar war (wenn auch noch nicht unter dieser Vokabel), man aber noch selbstverständlich davon ausging, die Gesellschaft würde sich dem Wissen anpassen, nicht aber umgekehrt. Gerade davon kann aber heute nicht mehr ernsthaft die Rede sein. Der von Weingart diagnostizierte Schwund der Distanz zwischen Wissenschaft und anderen sozialen Sektoren läßt die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wissenschaftliches Wissen gewonnen und angewandt wird, immer deutlicher werden. Im gleichen Maße kommt man heute auch von der Überzeugung ab, wissenschaftlich-technische Lösungen seien allem Natürlichen oder Traditionellen eo ipso überlegen. So sind etwa die Zeiten vorbei, in denen Müttern das Stillen mit dem Hinweis ausgeredet wurde, das sei doch angesichts moderner Milchpulvertechnologie nicht mehr nötig.
Insofern kann man den Distanzschwund auch positiv bewerten. Gerade dadurch könnte sich die Wissensgesellschaft ihre von wissenschaftsexternen Grundwerten geleitete freiheitlich-demokratische Basis sichern und damit womöglich auf lange Sicht selbst stabilisieren. Ihr großes Problem dabei bleibt, daß sie bei der Reflexion auf ihre eigenen Bedingungen auf einen ihr wesensfremden Typ von Wissen zurückgreifen muß und daß zur Hervorbringung dieses Wissens immer wieder Fragen beantwortet werden müssen, die sich der Wissenschaft letztlich entziehen.
Die Verdrängung oder Leugnung dieses inhärenten, unaufhebbaren Defizites der Wissensgesellschaft ist vielleicht einer der Gründe dafür, warum manche Zeitgenosssen sich zur Wissensgesellschaft in einer Weise verhalten, die angesichts ihrer Errungenschaften seltsam anmuten muß.
Drei dieser Haltungen lassen sich unterscheiden. Die erste könnte man als "romantische Verweigerung" bezeichnen. Romantische Verweigerer versuchen das als entfremdend wahrgenommene Fortschreiten des Wissens aufzuhalten, und nicht selten setzen sie der Wissensgesellschaft ein vereinfachtes und verklärtes Bild einer vermeintlich besseren Vergangenheit ohne die Dominanz von Technik und Wissenschaft entgegen. Die meisten romantischen Verweigerer schaden der Wissensgesellschaft aber höchstens dadurch, daß sie sich und ihre Fähigkeiten von ihr fernhalten. Andererseits kann ihre Kritik durchaus nützen. Auch ist der Grad der Verweigerung sehr unterschiedlich. Es gibt keine wirklich scharfe Grenze zwischen denen, die sich wirklich verweigern, und denen, die es lediglich an Enthusiasmus für die Wissensgesellschaft fehlen lassen und auf ihre Probleme, darunter die hier bedachten, aufmerksam machen wollen.
Verweigerung, Ignoranzkult
und das Elend der Esoterik
Romantische Verweigerer findet man in der Regel eher unter den intellektuell Aktiveren. Am anderen Ende des gesellschaftlichen Spektrums dominiert ein ganz anderer Typ von Rebellion gegen die Wissensgesellschaft. Man könnte ihn als "Kult der Ignoranz" bezeichnen. Er äußert sich, salopp gesagt, in einer Verachtung von Wissen als "uncool". Sichtbar geworden ist der Ignoranz-Kult vor allem als Medienphänomen. Man erinnere sich nur an den "Big Brother"-Star Zlatko, der seine Popularität Bekenntnissen verdankt wie dem, nicht zu wissen, wer Shakespeare sei. Und mit Verona Feldbusch trat ein Mediengeschöpf vor die Kameras, dessen vorgespielte Mängel in grundlegenden Wissenstechniken einen Teil ihres öffentlichen Bildes ausmachten. Obwohl solche Phänomene sicher auch noch andere Gründe haben, lassen sie sich unschwer als Reaktion von Menschen auf Überforderungen durch die Wissensgesellschaft interpretieren: Die tumben Stars kommen deshalb gut an, weil sie die entlastende Illusion erzeugen, gesellschaftliches Ansehen lasse sich auch für den erreichen, der den Anforderungen der Wissensgesellschaft nicht gewachsen ist. Die Gefahren liegen auf der Hand: Die Menschen werden vom Wissen ferngehalten, ohne daß es ihnen erlaubt wäre, aus der Wissensgesellschaft auszusteigen. Ihre Entfremdungssymptome werden nur übertüncht. Vor allem aber: Sie sind als Wähler wie als Verbraucher den Manipulationen derer ausgeliefert, die längst erkannt haben, daß man auch Werbung wissenschaftlich perfektionieren kann.
Eine dritte Art der Reaktion gegen die Wissensgesellschaft ist die sogenannte Esoterik. Dieser schillernde, in seinem Gebrauch ziemlich variable Begriff soll hier vom Schamanenwissen bis zur Bachblütentherapie all jenes Wissen über die sichtbare Welt zusammenfassen, bei dem es nach akademisch anerkannten Standards an der Begründbarkeit hapert. Interessanterweise sind esoterische Neigungen in allen gesellschaftlichen Schichten anzutreffen - auch unter Akademikern. Das hat sicher auch damit zu tun, daß es sich bei der Esoterik um ein soziales Phänomen handelt, das entschieden im Gewande der Wissenschaft auftritt. In ihren para- und pseudowissenschaftlichen Formen unterscheidet sie sich von orthodoxer Wissenschaft oft nur in subtilen (aber letztlich entscheidenden) methodischen Details.
Esoterik ist gerade dort attraktiv, wo die orthodoxe Wissenschaft den Wissensbedarf der Menschen eben nicht decken kann - ob das nun Fragen individuellen Handelns betrifft oder die Dilemmata der Nichtwissensgesellschaft. Statt diese Unsicherheit und Unabsicherbarkeit auszuhalten und traditionelle, dezidiert nichtwissenschaftliche Maßnahmen - etwa Gebete - zu bemühen, wünschen sich die Esoteriker eine Wissenschaft herbei, die ihnen in allen Lebenslagen durch forschungsförmige Aktivitäten abgesicherten Rat erteilt, ob es nun um magnetische Wasserentkal-kung, sanfte Krebsheilung oder astrologisch unterstützte Partnerwahl geht. Esoterik ist also gerade kein Ausdruck einer Verachtung der Wissensgesellschaft, sondern im Gegenteil Ausdruck ihrer zuweilen maßlosen Überschätzung.
Von den skizzierten Reaktionstypen auf die Defizite der Wissensgesellschaft ist die Esoterik vielleicht der problematischste. Denn erstens werden auch die Konsumenten esoterischen Wissens leicht Opfer von Manipulationen wirtschaftlich interessierter Kreise, von Scharlatanen und Quacksalbern. Hinzu kommt, daß Esoterik die Probleme der Wissensgesellschaft nicht nur nicht löst, sondern ihre Errungenschaften regelrecht zunichte machen kann. So gibt es Mütter, die sich auf Anraten obskurer Homöopathen weigern, ihren Babys im ersten Lebensjahr zusätzlich Vitamin D zu geben, und so riskieren, daß die Kinder Rachitis bekommen.
Die ethischen Normen, die Esoteriker ihren jeweiligen Lehren zuweilen auch entnehmen, sind natürlich genausowenig durch Forschung absicherbar wie die traditionellen Normen auch. Dennoch gerieren sie sich als methodisch gesichertes Wissen. Konsequent esoterische Fraktionen der Wissensgesellschaft sind daher nicht mehr in der Lage, die Probleme überhaupt zu erkennen. Ihr Weltbild ist wissenschaftsförmig - und kann sich daher modern vorkommen - und ist zugleich so geschlossen wie in magischen Kulturen. Auch deshalb ist Esoterik am Ende sogar gefährlicher als Ignoranz oder Verweigerung: weil sie ihren Adepten eine Harmonie zwischen Wissen und Werten vorgaukelt, die es nicht gibt.
In der kommenden Woche erscheint Ulf von Rauchhaupts Buch "Wittgensteins Klarinette. Gegenwart und Zukunft des Wissens".
Text: F.A.Z., 28.05.2005, Nr. 121 / Seite 39
... link
... comment