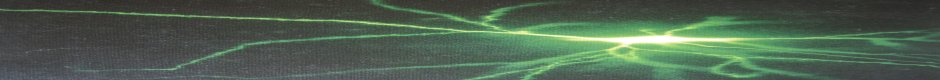Dienstag, 5. April 2005
Selbst schuld
synapse, 19:17h
Im Feuilleton der FAZ Gespräch zwischen Schirrmacher, Raffelhüschen und Barbier.
Wer heute vierzig ist, schaue in den Spiegel und sage "Selbst schuld!"
Gespräch zum Überfliegen im Kommentar.
daraus:
Frage: Sind wir gerade in dem richtigen Moment dabei, die Regler umzustellen, oder gibt es bereits jetzt, was das Gefühl vieler Leute ist, eine "Lost Generation", die vielleicht den Geburtsjahrgang 1960 bis 1970 hat, die die Zeche zahlen muß?
Raffelhüschen:
...
Die aber, die wir nicht in Ruhe lassen, sind die anderen, sind die jetzigen Erwerbstätigen und die Jüngeren. Und da verteilen wir die Last relativ stark dominant in die Mitte. Bei allen Reformen, die sie gesehen haben, ob das der Nachhaltigkeitsfaktor ist, die Rente mit 67, ob das die Vorschläge in der Gesundheit oder auch die Vorschläge bei der Pflege sind, wir sind immer bei den Dreißig- bis Fünfzigjährigen, die die stärksten Lasten zu tragen haben, und das ist gerecht so. Man muß meiner Generation schlichtweg sagen, schaut in den Spiegel, ihr seht das Problem und vergeßt dabei nicht, das "mea culpa" aufzusagen.
Schirmmacher: Und die Schuld ist, keine Kinder in die Welt gesetzt zu haben?
RAFFELHÜSCHEN: So ist es. Unsere Generation hat völlig freiwillig auf Kinder verzichtet. Sie ist nie im Leben von irgend jemandem dazu gezwungen worden. Wir haben das freiwillig gemacht, und wir haben es genossen. Das hat aber seinen Preis, und den müssen wir den Leuten jetzt nennen.
Dazu Barbier mit seiner altbekannten Meinung.
BARBIER: Man soll eine Gesellschaft als Ganze nicht personalisieren. Aber eigentlich liegt doch der Gedanke nicht fern, eine Gesellschaft habe das Recht, sich das demographische Bild zu geben, das sie hat und mit dem sie in ihre eigene Zukunft geht. Natürlich kann man über allerlei Einrichtungen nachdenken, die das Kinderkriegen und die Berufstätigkeit miteinander verträglicher machen. Aber es haftet doch viel Illiberales an Aufrufen und Anrufungen, es müsse wieder eine Mentalität des Kinderkriegens her.
Wer heute vierzig ist, schaue in den Spiegel und sage "Selbst schuld!"
Gespräch zum Überfliegen im Kommentar.
daraus:
Frage: Sind wir gerade in dem richtigen Moment dabei, die Regler umzustellen, oder gibt es bereits jetzt, was das Gefühl vieler Leute ist, eine "Lost Generation", die vielleicht den Geburtsjahrgang 1960 bis 1970 hat, die die Zeche zahlen muß?
Raffelhüschen:
...
Die aber, die wir nicht in Ruhe lassen, sind die anderen, sind die jetzigen Erwerbstätigen und die Jüngeren. Und da verteilen wir die Last relativ stark dominant in die Mitte. Bei allen Reformen, die sie gesehen haben, ob das der Nachhaltigkeitsfaktor ist, die Rente mit 67, ob das die Vorschläge in der Gesundheit oder auch die Vorschläge bei der Pflege sind, wir sind immer bei den Dreißig- bis Fünfzigjährigen, die die stärksten Lasten zu tragen haben, und das ist gerecht so. Man muß meiner Generation schlichtweg sagen, schaut in den Spiegel, ihr seht das Problem und vergeßt dabei nicht, das "mea culpa" aufzusagen.
Schirmmacher: Und die Schuld ist, keine Kinder in die Welt gesetzt zu haben?
RAFFELHÜSCHEN: So ist es. Unsere Generation hat völlig freiwillig auf Kinder verzichtet. Sie ist nie im Leben von irgend jemandem dazu gezwungen worden. Wir haben das freiwillig gemacht, und wir haben es genossen. Das hat aber seinen Preis, und den müssen wir den Leuten jetzt nennen.
Dazu Barbier mit seiner altbekannten Meinung.
BARBIER: Man soll eine Gesellschaft als Ganze nicht personalisieren. Aber eigentlich liegt doch der Gedanke nicht fern, eine Gesellschaft habe das Recht, sich das demographische Bild zu geben, das sie hat und mit dem sie in ihre eigene Zukunft geht. Natürlich kann man über allerlei Einrichtungen nachdenken, die das Kinderkriegen und die Berufstätigkeit miteinander verträglicher machen. Aber es haftet doch viel Illiberales an Aufrufen und Anrufungen, es müsse wieder eine Mentalität des Kinderkriegens her.
... comment
synapse,
Dienstag, 5. April 2005, 19:18
Ordnung des Landes (9)
Wer heute vierzig ist, schaue in den Spiegel und sage "Selbst schuld!"
Ordnung des Landes (9): Wer soll welche Risiken tragen? Hans D. Barbier trifft Bernd Raffelhüschen zum Gespräch über die Renten, den Wohlfahrtsstaat und die Bevölkerungsentwicklung
Herr Raffelhüschen, eine ganz einfache Frage: Welche Farbe hat unsere Zukunft? Also wie dunkel oder wie hell ist unsere Zukunft, Wissensstand Anfang 2005?
RAFFELHÜSCHEN: Plakativ gesagt, die Farbe der Zukunft ist grau meliert. Das ist die dominante Stimmung, sowohl in der Bevölkerung wie auch bei den Politikern selbst. Tatsächlich haben wir ja auch einiges geschafft, also keine schwarze Zukunft, sondern eine gewissermaßen geweißte oder ins Graue spielende. Wir sind gar nicht so weit weg, zum Beispiel bei der Rente, von einem Zustand, den man nachhaltig verbessert nennen könnte.
Sie können sich eine Situation vorstellen, in der die heute Vierzig- bis Fünfundvierzigjährigen und die darunter liegenden Jahrgänge tatsächlich wieder mit einer gewissen Sicherheit, was auch ihre eigene Rente angeht, in die Zukunft blicken?
RAFFELHÜSCHEN: Ja, denn die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors ist zumindest die zweitgrößte Rentenreduktion, die es jemals in der deutschen Geschichte gegeben hat. Wir haben die Rente ja im Prinzip für die heute Dreißig- bis Vierzigjährigen um bis zu fünfzehn Prozent gekürzt. Das sind drastische Kürzungen. Wir haben bei der Rente im wesentlichen die Weichen richtig gestellt. Das heißt: Man muß länger arbeiten, und dafür bekommt man weniger Rente. Das mit der geringeren Rente haben wir geregelt, das mit der längeren Lebensarbeitszeit kommt noch.
Alle, die die alte Bundesrepublik noch kannten, haben das Gefühl, daß in der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands Phasen eines wirklichen Aufschwungs immer wieder kommen. Mittlerweile scheint es aber so zu sein, als gingen wir in eine Zukunft, in der wir aufgrund der demographischen Parameter froh sein können, wenn wir gerade noch den Status quo halten.
BARBIER: Die Vorstellung vom Aufschwung wird im wesentlichen durch zwei Phänomene gestützt. Das ist einmal der Konjunkturaufschwung. Der ist relativ kurzfristig, und man weiß auch nicht immer, woher er kommt. Er läßt einen als statistisches Ereignis eigentlich nicht im Stich, er löst aber auch keine Probleme, die mit den Institutionen der Gesellschaft zu tun haben: Eigentumsverhältnisse, Vertragsrecht, Qualität der Ausbildung, Entscheidungen für oder gegen den technischen Fortschritt. Zum anderen ist das der Wachstumsaufschwung, ein Wachstumstrend. Hier müssen wir uns die Einsicht wieder aneignen, daß Wohlstand nicht von der Verteilung kommt, sondern von der Produktion. Wenn wir mehr produzieren wollen, müssen wir mehr leisten.
RAFFELHÜSCHEN: Das, worüber wir reden, ist in der Tat ein Wachstumstrend, und dieser Trend ist in den letzten Jahren abgeflacht, und wir müssen aufpassen, daß er durch die demographische Entwicklung nicht weiter abflacht. Denn ein Alterungsprozeß in der Gesellschaft kostet Wachstumspunkte. Wahrscheinlich nicht so viele, wie die meisten Schwarzseher befürchten, aber ein wenig doch. Wir müssen uns also darüber unterhalten, wenn wir weiterhin das reichste Deutschland bleiben wollen, das wir jemals hatten.
Deutschland ist heute reicher als in den achtziger und neunziger Jahren?
RAFFELHÜSCHEN: Aber natürlich! Wir sind immer weiter gewachsen. Wir sind das reichste Deutschland, das es jemals gab. Wir haben die reichsten Rentner und die reichsten Erwerbstätigen, die es jemals gab. Nur es ist völlig richtig, daß, wenn der Trend abgeflacht ist, daß wir uns dann überlegen sollten, wie wir das Produktionspotential, das uns zur Verfügung steht, und das ist schlichtweg nur durch Arbeit sowie durch Kapital bedingt, erhöhen. Und da spielt die Arbeitszeitdiskussion eine Rolle. Wir müssen in jedem Fall die Lebensarbeitszeit erheblich verlängern. Wir werden auf siebenundsechzig Jahre beim Renteneintrittsalter gehen müssen und beim öffentlichen Dienst noch darüber hinaus.
Was man dann immer wieder hört, ist: "Länger arbeiten, das ist doch absurd, es gibt doch jetzt schon so viele Arbeitslose."
RAFFELHÜSCHEN: Man muß sich den Arbeitsmarkt ganz anders vorstellen. In den letzten zwanzig Jahren hatten wir einen Arbeitsmarkt, auf dem im Grunde genommen die Zahl derjenigen, die in ihn hineingingen, doppelt so groß war wie die Zahl derjenigen, die aus ihm austraten. In den nächsten zwanzig Jahren kehrt sich das genau um. Das heißt dann auf jeden Fall, daß sich die Lebensarbeitszeit verlängert. Hieran führt kein Weg vorbei. Die anderen Diskussionen sind Arbeitsmarktdiskussionen, die mit der Rentenversicherung nichts zu tun haben. Da geht es um die Jahresarbeitsleistung. Worüber wir reden sollten, ist eine Flexibilisierung; was wir diskutieren sollten, ist zum Beispiel, wie wir die Brückenwochenenden loswerden, wenn Feiertage auf einem Donnerstag liegen.
Nehmen wir an, es würde ein Wunder passieren, und ganz Deutschland in jedem Erwerbszweig würde auf eine Woche Urlaub verzichten. Gibt es da eine verantwortungsvolle Berechnung, was daraus folgen würde? Wenn man einfach einmal so ein Zeichen setzen würde, auch im Sinne des Aufbruchsgedankens: Verzichtet alle auf eine Woche Urlaub, dann ginge es uns besser.
BARBIER: Das klingt immer ein bißchen wie eine Reichskriegsreserve. Wir arbeiten jetzt alle einen Tag, und davon macht die Hälfte der Bevölkerung Einheitsmarmelade, die lagern wir in großen Eimern und können sie später verteilen, und die anderen machen etwas anderes. Ich glaube nicht, daß man das mit viel Sinn machen kann.
Also das ist kein Weg?
BARBIER: Noch einmal zu dem Argument "Wenn wir jetzt mehr arbeiten, dann gibt es ja wieder mehr Arbeitslose." Die Leute, die so argumentieren, denken ganz offensichtlich nur an eine ganz bestimmte Menge an ökonomisch verwertbarer Arbeit - nach dem Motto: wenn der Arbeiter A zehn Stunden mehr arbeitet, müssen die Arbeiter B und C ihre Arbeitszeit um jeweils fünf Stunden reduzieren. Aber so funktioniert eine Marktwirtschaft natürlich nicht. Angebot und Nachfrage gleichen sich nicht am Additionsstab aus, sondern über die Preise. Bei flexiblen Preisen kann es auf Dauer kein Überangebot geben. Natürlich gibt es immer auch dann immer wieder Situationen einer unfreiwilligen Arbeitslosigkeit - durch einzelne Unternehmenspleiten, durch größere Verschiebungen im internationalen Handel. Die davon Betroffenen drückt das selbstverständlich. Aber sie können sich aus dieser Situation durch Marktanpassung befreien. Gewährt man ihnen aber den vermeintlichen Schutz eines in seiner Höhe gesicherten Lohnes, dann wird möglicherweise aus einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit eine Dauerarbeitslosigkeit. Das Leben unter den Verhältnissen eines reglementierten und kartellierten Arbeitsmarktes wird nur scheinbar schöner.
Wenn es so ist, wie werden unsere Lebensläufe in der Zukunft dann aussehen? Wie wird sich zum Beispiel das Senioritätsprinzip entwickeln? Wird es weiterhin so sein, daß jemand, der älter ist, automatisch mehr verdient?
RAFFELHÜSCHEN: Die Produktivität des Menschen scheint ja ein Bergprofil zu haben. Jedenfalls stellen sich das viele so vor. Man erreicht seinen Leistungshöhepunkt Mitte bis Ende Vierzig, und dann schöpft man aus der Routine. Die Produktivität einer Arbeitskraft kommt aber sowohl aus Innovation als auch aus Routine. Das heißt auf gut deutsch, das Lohnprofil, das man sehen müßte, wäre nicht unbedingt ein nach hinten sinkendes Bergprofil, aber doch eines, das relativ flach verläuft - also in keinem Fall legitimiert es einen senioritätsbedingten Lohnanstieg am Ende der Erwerbstätigkeit. Aber wir werden uns sowieso an vieles Neue gewöhnen müssen. Wir müssen über die Arbeitszeit einer Hälfte unserer ganzen Bevölkerung diskutieren. Es kann nicht sein, daß die Frauen in dem Maße nicht erwerbstätig sind, wie sie es heute sind. Bei solchen Knappheiten von Arbeitern in der Zukunft müssen wir zu skandinavischen Arbeitsmarktbeteiligungen kommen, also dazu, daß es zwischen Männern und Frauen überhaupt keinen Unterschied in der Beteiligung am Arbeitsmarkt gibt.
Erleben wir im Augenblick eine Sozialrevolution unserer Gesellschaft in Dimensionen wie die großen sozialen Umbrüche Ende des neunzehnten Jahrhunderts?
BARBIER: Im neunzehnten Jahrhundert entstand ein neues Gesellschaftsbild durch die Technik. Es war eine neue Produktionstechnik entstanden, die einen ganz neuen Arbeitertyp, der eben massenweise in die Fabrik ging, geschaffen hat. Daraus erwuchsen hohe Produktivitätsfortschritte. Diese technische Veränderung wirkt nach, bis heute. Weit nachwirkend können natürlich auch gesellschaftliche Änderungen sein. Der heute ganz selbstverständliche Wunsch der Frauen nach Teilhabe an allen Chancen des Arbeitsmarktes gehört zu solchen Veränderungen. Das sieht man dann in den Büros, in den Statistiken zur Demographie, aber auch in den Rentenbescheiden. Wenn sich die gewohnten Muster der Sozialpolitik hieran nicht anpassen, zerbrechen sie.
RAFFELHÜSCHEN: Die Einfachheit der Rentenversicherung macht dort die Lösung einfach. Bei der Krankenversicherung ist es ganz anders. Da ist nur definiert, wer einzahlt, und schon das ist inzwischen in Frage gestellt. Die Arme, die hier in die Kasse reingreifen, sind nicht nur die der Rentner, es sind vielmehr Massen von Interessenvertretungen, und das macht die Lösung schwer. Immer dann, wenn Sie Massen von Interessenvertretungen haben, haben Sie Massen von Lobbyisten. Sie haben nicht zwei oder drei Stellschrauben, sondern eine ganze Apparatur, und die müssen Sie erst einmal verstehen und dann im Land verständlich machen, worum es geht.
Dann machen wir die Probe aufs Exempel: Nennen Sie die Vorschläge, die Sie überzeugend finden.
BARBIER: Mein Lieblingsvorschlag ist der Übergang zu einem Versicherungssystem. Versicherungen können uns helfen, Risiken kalkulierbar zu machen und sie damit - ökonomisch jedenfalls - zu bewältigen. Der Markt für Versicherungen bietet solche Sicherungen an: Einkommenssicherung für den Fall des frühen Todes oder eines schönen, langen Lebens nach der Zeit der Arbeit; Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen. Deren Leistungen sind berechenbarer als politische Zusagen der Zahlungskraft einer kollektiven Sicherung, die für allerlei Zwecke mißbraucht werden kann, die mit dem eigentlichen Versicherungsgegenstand - Alter, Gesundheit, Pflege - wenig oder gar nichts zu tun haben. Solche Versicherungspolicen werden nach dem Risiko kalkuliert. Dabei können Prämienbelastungen entstehen, die der eine oder andere nicht tragen kann oder von denen die Politik meint, daß er sie nicht allein tragen sollte. Dann bietet sich ein Weg der solidarischen Hilfe an: Wir zahlen diesen Mitbürgern einen Zuschuß aus dem allgemeinen Steueraufkommen. Das ist unter allen denkbaren Gesichtspunkten besser, als das Gebot der Solidarität zum Anlaß zu nehmen, die Beiträge "sozial" zu kalkulieren. Ehrlichkeit ist eine Tugend - das gilt auch für das Rechnen mit Risiken und Beiträgen und für die aus Steuern offen auszuweisende solidarische Hilfe.
RAFFELHÜSCHEN: Das eine ist, wie gestalte ich die Einnahmenseite in der Krankenversicherung, und das andere, wie reguliere ich die Ausgabenseite. Auf der Einnahmeseite diskutieren wir: Wie kriegen wir es hin, die Gesundheitskosten von den Löhnen zu entkoppeln? Wir können nicht all unsere Sozialleistungen von den Löhnen abzweigen. Wir haben keine Chance bei der Rente, und wir haben auch wahrscheinlich keine Chance bei der Pflege, die Lohnnebenkosten wirklich zu senken, also müssen wir den Weg über die Krankenversicherung gehen. Ihre Entkoppelung von den Löhnen ist ökonomisch sinnvoll, denn es ist nicht zu begreifen, warum man durch eine Lohnerhöhung krank werden sollte. Warum also sollte man nach einer Lohnerhöhung mehr Versicherungsprämien zahlen? Wenn man das erst einmal begriffen hat, weiß man, daß man auf der Einnahmenseite entweder auf ein individuelles Prämiensystem oder die Schweizer Lösung durch eine Kopfpauschale setzen muß. Die Bürgerversicherung hingegen verbreitert zwar die Bemessungsgrundlage, das heißt, sie nimmt Beamte und Selbständige an Bord. Damit aber nimmt sie den Sprengsatz der Beihilfe für Beamte, der jeden Länderhaushalt demnächst zur Detonation bringt, und packt ihn in eine Krankenversicherung. Die Aufnahme von Beamten wird die Krankenversicherung nur noch schneller ruinieren. Da muß man sich wirklich einfach nur die Statistik angucken, und schon weiß man, wie in etwa diese Zeitbomben ticken in den Länderhaushalten. Wenn wir zu Individualprämien oder Pauschalen kommen, dann muß man sich noch unterhalten, was gesellschaftlich zumutbar ist. Hier finde ich die ganze Diskussion schlichtweg verlogen, und zwar von allen Parteien. Alle gehen davon aus, daß der Mensch nun einmal nicht mehr als 12,5 oder 13 Prozent seines Einkommens für Gesundheit ausgeben darf. Das ist maximal zumutbar. Es ist ohne weiteres zumutbar, daß er mehr für Reisen oder für Autos oder für ähnliches ausgeben darf, aber für Gesundheit nicht. Wie auch immer man zu den Grenzen steht, eines ist in jedem Fall klar: Für Solidarität kann nicht der Beitragszahler zuständig sein. Wenn dem so wäre, wären Beamte, Reiche und Selbständige nicht mit einbezogen, und wenn sie eine Solidarität ohne diese drei Gruppen machen wollen, dann ist es eine Scheinsolidarität. Genau dies steht auf der Flagge der Bürgerversicherung. Die ist überhaupt nicht solidarisch, die ist genau das Gegenteil, es sei denn, Sie organisieren die Krankenversicherung nach englischem Vorbild, also als rein staatliches System ohne den letzten Rest von marktwirtschaftlichen Prinzipien. Wenn wir dann die Einnahmenseite solidarisch in Steuer und Äquivalenz einteilen, dann kommt eigentlich die schwerste Aufgabe. Dann kommt nämlich die Nachhaltigkeitsdiskussion, und das heißt: Wir brauchen marktwirtschaftliche Anreizmechanismen in der Ausgabenstruktur. Wir brauchen Gatekeeper, und zwar nicht den Hausarzt, der im Moment jede Überweisung schreibt, die wir haben wollen. Wir brauchen die Preisfühlbarkeit, wir brauchen das, was den Markt eigentlich ausmacht, die unsichtbare Hand der dezentralen Entscheidung.
Und wie begreift man die Preisfühlbarkeit? Indem man doch selbst dafür aufkommt beziehungsweise eine Prämie bekommt, wenn man sich entsprechend weniger untersuchen läßt und gesünder lebt?
RAFFELHÜSCHEN: Die Kunst heißt jetzt, die Anreize so zu setzen, daß die Rahmenbedingungen das Ergebnis so weit steuern, daß das Ziel auch tatsächlich erreicht wird. Wir sprechen da im stationären Bereich über ganz andere Dinge als bei ambulanter Behandlung. Die Steuerungswirkung des Preises kann ohne weiteres in weiten Teilen der ambulanten Behandlung, bei Heil- und Hilfsmitteln und auch bei Medikamenten greifen. Ich würde schlichtweg die Sachleistung in diesen Bereichen fallenlassen und auf eine Kostenerstattung übergehen. Will heißen: Jeder bekommt seine Rechnung, jeder zahlt seine Rechnung, jeder kontrolliert seine Rechnung, und keiner bekommt seine Rechnung vollständig erstattet.
Und das ist in Ihren Augen eine Möglichkeit, mit der man das Gesundheitssystem retten könnte?
RAFFELHÜSCHEN: Das ist die einzige Art, wie wir wirklich die Effizienzreserven heben, indem wir Individuen selbst entscheiden lassen, was für sie zum Beispiel Bagatellmedizin ist. Dann würde durch den Selbstbehalt - der ja hoch sein muß, und in der Schweiz ist er ja schon bei mehr als vierhundert Euro - der normale Besuch beim Arzt immer vom Individuum selbst bezahlt. Und das muß auch so sein.
Aber was heißt das denn jetzt von den Werten her? Wieviel Prozent der Bevölkerung können sich das dann leisten? Da fallen doch einige aus dem Raster.
BARBIER: In der sorgenden Formulierung, jemand falle durchs Netz, klingt etwas Schicksalhaftes an, was dann gegen die Wahl von Marktlösungen oder individuellen Entscheidungen zu sprechen scheint. Die meisten von guten Ökonomen vorgeschlagenen Reformen der Sozialeinrichtungen laufen darauf hinaus, die Kosten der Sicherung zu offenbaren. Heute werden die Kosten im unklaren gehalten. Das führt dazu, daß viele Bürger die Kosten der Vorsorge unterschätzen. Ginge man zu risikokalkulierten Prämien über, dann würde manchem klarer, daß die Vorsorge auch eine Entscheidung in der Abwägung zum Gegenwartsverbrauch ist: längere Ferienreise oder bessere Krankenversicherung - warum sollte man diese Abwägung für unzumutbar halten, da sie doch realwirtschaftlich unvermeidbar ist?
Um das genau zu verstehen: Ein Mensch der Zukunft wäre bis zu einem gewissen Grad versichert. Wenn er jetzt eine Operation hätte, vielleicht eine Herzoperation, die einhunderttausend Euro kostet, welchen Rest trägt er dann selber?
RAFFELHÜSCHEN: Es kommt drauf an. Zunächst trägt jeder im Grunde seine Rechnung selbst und zwar bis zur jährlichen Eigenbeteiligung, die in der Größenordnung von fünfhundert, sechshundert, vielleicht sogar tausend Euro liegt. Die Diskussion, die wir führen müssen, ist schlichtweg die, zu sagen: Wo ist für alle das Minimum dessen, was sie selbst tragen müssen und können? Es geht um den minimalen Selbstbehalt, den wir diskutieren. Nach oben hin können wir das freie Spiel der Marktkräfte laufen lassen. Aber das, was selbst zu leisten ist, das ist zu diskutieren. Und hier dürfen wir nicht zu niedrig ansetzen, sonst sind die Anreizwirkungen nicht ausreichend.
BARBIER: Und deshalb meinte ich, daß viele Familien in diesem Szenario ihre Urlaubspläne überdenken müßten und dazu kämen, daß es wahrscheinlich klüger ist, das Geld in ihre Gesundheit zu stecken. Aber ohne Kostenklarheit ist nicht gut rechnen - auch nicht, wenn man rechnen will.
RAFFELHÜSCHEN: Das, was wir jetzt noch diskutieren müssen, ist das reine Armutsproblem: Wenn jemand eine Prämie zahlt, und die ist schon sehr hoch, und er hat beispielsweise das Pech einer kostenintensiven chronischen Krankheit - lassen wir den allein? Also wen genau wollen wir unterstützen? Eines ist klar, wir müssen eine bestimmte Versorgung garantieren, dafür sind wir eine Gemeinschaft. Die andere Diskussion ist die fatale Neiddiskussion: Man will lieber Gleiches. Gleiches ist aber nicht immer gerecht. Es wird immer so bleiben, daß der Reiche sich mehr kaufen kann als der Arme, auch mehr Medizin. Wer dagegen angeht, unterminiert die Diskussion darüber, was die Gemeinschaft jedem zubilligt.
Aber wenn jemand die Prämie zahlen kann und hat dann eine chronische Krankheit, dann ist er doch versichert, oder nicht?
RAFFELHÜSCHEN: Nein, wenn die chronische Krankheit eine sehr teure Krankheit ist, würde er diesen Selbstbehalt von fünf-, sechs-, siebenhundert Euro im Jahr zusätzlich zu der Prämie natürlich auch nicht aufbringen müssen. Dann müssen wir ihm helfen. Aber was, wenn dieser Mann, dieser chronisch Kranke Millionär ist? Warum sollen wir als Gemeinschaft einem chronisch kranken Millionär helfen?
Der Normalfall wird aber auch hier wieder sein, daß das Bürgertum oder der Mittelstand wieder vor einer irrsinnigen Transformation steht.
RAFFELHÜSCHEN: Ja, genau hier ist das Problem. Wir haben immer Sozialpolitik betrieben, die eine Art Koalition des unteren Mittelstands mit den Armen war, und diese Koalition muß aufgebrochen werden.
BARBIER: Es zeichnet sich immer mehr ab, daß der sogenannte untere Mittelstand auch das Opfer dieser Politik geworden ist. Die sozial gemeinten Regulierungen des Arbeitsmarktes haben diesen unteren Mittelstand in die Massenarbeitslosigkeit getrieben. Ein Mitglied dieser Gruppe des unteren Mittelstandes kann durch die Fernwirkung des internationalen Handels von einem Chinesen auskonkurriert werden, er kann aber nicht in die Forschungslandschaft einer amerikanischen Hochschule auswandern. Er muß hier sein Geld verdienen, und es kann nicht sozial sein, ihn daran zu hindern.
Wenn ich mir Dreißig- oder Vierzigjährige anschaue, kann man ja jetzt schon sehen, wie sich das Konsumverhalten verändert. Das hat zu tun mit der Überlegung: Es kommen so viele Unklarheiten auf mich zu, ich werde lieber mein Geld zur Seite legen. Damit entfällt doch einer der notwendigen Parameter, die Sie auch immer lehren, daß nämlich auch Geld zum Konsum dasein muß.
RAFFELHÜSCHEN: Es ist absolut notwendig die Kapitalbildung zu forcieren. Dies schon deshalb, damit die wenigen Köpfe, die morgen dasein werden, dann so produktiv sind, daß sie das zu leisten vermögen, was wir ihnen durch die Generationenverträge alles aufbürden. Man muß sich auch klarmachen: Wir hatten Sparquoten in den sechziger und siebziger Jahren in Deutschland, die lagen etwa
bei zwölf Prozent. Wir sind auf unter
zehn Prozent gesunken. Und jetzt steigen wir wieder über zehn Prozent und
sind auf dem Wege zu elf Prozent. Wir haben noch immer nicht die Sparquote unserer Elterngeneration erreicht. Und wer dann sagt, es gibt riesige Konsumeinbrü-
Fortsetzung auf der folgenden Seite
Text: F.A.Z., 05.04.2005, Nr. 78 / Seite 36
che, der sollte sich dann mal das Konsumniveau zwischen 1960 und 1980 anschauen.
Sind wir gerade in dem richtigen Moment dabei, die Regler umzustellen, oder gibt es bereits jetzt, was das Gefühl vieler Leute ist, eine "Lost Generation", die vielleicht den Geburtsjahrgang 1960 bis 1970 hat, die die Zeche zahlen muß?
RAFFELHÜSCHEN: Hier sollte man ein wenig vorsichtiger sein. Wir haben das gleiche Problem wie alle anderen, zwar etwas stärker, aber wir sind dabei umzurudern. Die Belastungen haben wir jetzt zu verteilen, und da sind wir im wesentlichenimmer bei derselben Frage: Wer ist eigentlich der Verursacher der Probleme? Jetzt ist meine Generation dran, denn meine Generation hat immer geglaubt, sie habe ein Problem, und sie hat nicht realisiert, daß sie selbst die Ursache des Problems ist. Wenn das zutrifft, ist es zwangsläufig richtig, den Verursacher mit stärkeren Lasten zu belasten. Wir entlasten zukünftige Generationen und belasten uns, und dabei nehmen wir die Graumelierten etwas aus. Denn sie sind Motor gewesen, sie haben ihre Bringschuld geleistet, sie haben Kinder in die Welt gesetzt, Wachstum produziert und jahrzehntelang eingezahlt, und dafür werden wir sie auch in Ruhe lassen. Die aber, die wir nicht in Ruhe lassen, sind die anderen, sind die jetzigen Erwerbstätigen und die Jüngeren. Und da verteilen wir die Last relativ stark dominant in die Mitte. Bei allen Reformen, die sie gesehen haben, ob das der Nachhaltigkeitsfaktor ist, die Rente mit 67, ob das die Vorschläge in der Gesundheit oder auch die Vorschläge bei der Pflege sind, wir sind immer bei den Dreißig- bis Fünfzigjährigen, die die stärksten Lasten zu tragen haben, und das ist gerecht so. Man muß meiner Generation schlichtweg sagen, schaut in den Spiegel, ihr seht das Problem und vergeßt dabei nicht, das "mea culpa" aufzusagen.
Und die Schuld ist, keine Kinder in die Welt gesetzt zu haben?
RAFFELHÜSCHEN: So ist es. Unsere Generation hat völlig freiwillig auf Kinder verzichtet. Sie ist nie im Leben von irgend jemandem dazu gezwungen worden. Wir haben das freiwillig gemacht, und wir haben es genossen. Das hat aber seinen Preis, und den müssen wir den Leuten jetzt nennen.
Können Sie in diesen Zusammenhang einmal die Pflegeversicherung einbetten?
BARBIER: Die Einführung einer Absicherung des Pflegerisikos war gut begründbar. Die gewählte Form aber ist unentschuldbar. Sachverstand hätte dafür gesprochen, eine Pflegeversicherung nach Risikokalkulation einzuführen. Für die Anlaufjahre, also für die sogenannten pflegenahen Jahrgänge, hätte man eine ergänzende Lösung finden können: zum Beispiel einen Zuschuß zu den notwendigerweise hohen Prämien. Doch das war nicht gewollt. Es ging nach politischem Kalkül. Das Umlageverfahren verschiebt die Kosten in die Zukunft. Daß Norbert Blüm diese Zukunftsbelastung offenen Auges gewählt hat, bleibt seine Schuld. Es ist ungerecht, daß er sie nicht abzutragen hat.
RAFFELHÜSCHEN: Richtig, es ist die Wahl 1994 gewesen und das Verteilen von Wahlgeschenken. Und wieder profitierte der Mittelstand, denn der ist der große Gewinner. Es waren nicht die Armen, die durch die Pflegeversicherung bessergestellt worden sind. In Kiel kursierte schon damals immer das Wort "Erbschaftsbewahrungsprogramm", und das war es auch.
Aber stimmt es nicht, daß das "Bürgertum", also die Mittelschicht in dem Land, am meisten geblutet hat? Es gab in den achtziger und neunziger Jahren sogar die Debatte, was ein Besserverdienender ist, diese Definition hat sich immer mehr erweitert, so daß heute eigentlich ein Facharbeiter schon fast als Hochverdiener gilt. Also die Mittelschicht hat schon den Eindruck, daß die Reformen gegen sie gelaufen sind.
RAFFELHÜSCHEN: Ja, aber die Pflegeversicherung ist ein Beispiel für das Gegenteil. Man hätte niemals eine lohnbezogene Beitragskonstruktion beschließen dürfen, weil man durch eine Lohnerhöhung weder krank noch pflegebedürftig wird. Adenauer konnte noch sagen, in den letzten zehntausend Jahren war Kinderkriegen kein Problem. Aber die Blüms und die Dreßlers dieser Welt konnten das 1995 nicht. Die wußten, daß es seit dreißig Jahren den Pillenknick bereits gegeben hatte. Man wußte auch, wie teuer es war, denn man kannte die entsprechenden Ausgabenprofile. Man wußte auch, wie schnell man Sozialhilfeempfänger wird, selbst als Gutverdienender, wenn man nämlich in die Pflegebedürftigkeit kam, also war klar, daß man eine Versicherungspflicht hätte setzen müssen, es war klar, daß man etwas tun mußte, weil es ein soziales Risiko ist. Langlebigkeit bedingt Pflege. Wir hätten etwas tun müssen, aber nicht so. Die Politik ist sehenden Auges ins Messer gerannt, um etwas für einen Wahlkampf herauszuholen.
Ein anderes Thema: Gibt es aus Ihrer Sicht Gründe, die Mütter anders zu stellen in unserer Gesellschaft, ob sie jetzt verheiratet sind oder nicht? Oder ist genug getan?
RAFFELHÜSCHEN: Wir müssen nicht über Mütter, sondern über die Familie diskutieren. Der Erzieher kann nichts ohne den Ernährer, wobei der Erzieher hier erst einmal geschlechtslos ist. Ich würde es gar nicht einmal daran festmachen. Die Tatsache, daß sich zwei Menschen zusammentun und sagen, wir machen das, damit wir die Kinder stützen, um etwas weiterzugeben, das muß von der Gesellschaft honoriert werden, und ich glaube, da sind wir in unserer Gesellschaft zu lapidar. Wir sind zu kurzlebig, kümmern uns nur noch um die nächsten zwei, drei Tage. Da ist die Gemeinschaft eben sehr schnell dabei zu sagen, Familie sei Privatsache. Das ist sie nicht. Familie ist etwas Gesellschaftliches. Und aus diesem Nukleus wächst sehr viel Stabilität, sehr viel Zukunft. Zukunft ohne Familie ist gar nicht da.
BARBIER: Man soll eine Gesellschaft als Ganze nicht personalisieren. Aber eigentlich liegt doch der Gedanke nicht fern, eine Gesellschaft habe das Recht, sich das demographische Bild zu geben, das sie hat und mit dem sie in ihre eigene Zukunft geht. Natürlich kann man über allerlei Einrichtungen nachdenken, die das Kinderkriegen und die Berufstätigkeit miteinander verträglicher machen. Aber es haftet doch viel Illiberales an Aufrufen und Anrufungen, es müsse wieder eine Mentalität des Kinderkriegens her.
Gibt es denn Modelle, wie man Anreize schaffen kann in einem Wirtschaftssystem, daß man sagt, jetzt werden sich viel mehr bereit erklären, Kinder zu haben?
BARBIER: Für mich wirken die Vorschläge, die man am meisten hört, doch ziemlich ausgedacht und im Licht der Praxis eigentlich nicht so sehr überzeugend. Bleiben wir einmal bei dem naheliegenden Fall der Kinderbetreuung im Unternehmen. Da hat man offenbar das Bild der jungen Frau, die morgens mit einem oder zwei Kindern ankommt. Die Kinder sind gesund und spielen unter der Aufsicht einer Dame aus der Sozialabteilung. Was aber ist, wenn die Kinder Windpocken haben? Was tut dann die junge Bankangestellte, die, wir sind hier in Frankfurt, eigentlich eine Tageskonferenz der Europäischen Zentralbank beobachten sollte und wollte? Wie viele Windpockenattacken übersteht die Dame in der Frühphase ihrer Karriere? Solche Fragen müssen nicht das letzte Wort zu allerlei gutgemeinten Vorschlägen sein. Aber die Vorschläge müssen sich doch auf Gebrauchstüchtigkeit testen lassen.
Zum Abschluß noch eine Frage, Herr Raffelhüschen: Sie als Professor, als einer, der ja auch mit jungen Leuten zu tun hat, bemerken Sie auch in Ihrem Gebiet Abwanderungsgedanken bei guten Nachwuchskräften? Oder ist das kein großes Thema?
RAFFELHÜSCHEN: Bei uns am Institut haben wir schon immer die Kontakte mit den Vereinigten Staaten gepflegt. Ich bin selbst eine "Rückholaktion". Wir sind aber auch mit Skandinavien verzahnt durch meine Professur in Norwegen. Also bei uns ist es immer so, daß es nicht Abwanderung ist, sondern man geht immer für eine gewisse Zeit und kommt wieder.
Aber müssen wir nicht damit rechnen, daß die guten, hochqualifizierten Leute nach Amerika oder sonstwohin abwandern?
RAFFELHÜSCHEN: Es gehen immer Hochqualifizierte nach Amerika. Gott sei Dank kommen auch immer einige zurück. Ich glaube, wenn das letztere nicht mehr passiert, dann haben wir ein Problem. Wir haben drei, vier gute Köpfe wieder zurückgeholt in den letzten Jahren in den Wirtschaftswissenschaften, und wir werden das hoffentlich weiter schaffen. Das kann sich ändern. Aber, wie gesagt, erst dann, wenn sich das ändert, dann werden wir ein Problem haben.
Wenn Sie aus dem Bewußtsein heraus, welches Sie im Augenblick haben, und dem Kenntnisstand über demographische, wirtschaftliche, ökonomische Parameter der Länder dieser Erde entscheiden müßten, in welchem Land, das uns umgibt, würden Sie denn gerne wohnen?
RAFFELHÜSCHEN: Die Antwort meines Herzens ist ganz schlichtweg: Ich lebe am liebsten hier. Das ist ein Land, in dem meine Kinder groß werden, in dem meine Eltern groß geworden sind, das sie aufgebaut haben. Ich habe keine Probleme mit diesem Land. Ich gehe aber auch immer mal wieder gern raus, und ich glaube, dieses Land begreift man auch erst mit dem Blick von außen. Man begreift oft auch erst, wie gut es eigentlich dasteht, wenn man sich das von außen angeschaut hat.
Wenn man aus Amerika oder aus Skandinavien auf uns schaut?
RAFFELHÜSCHEN: Auch wenn man aus Skandinavien auf uns schaut, und das habe ich oft getan, und auch wenn man aus Amerika auf uns schaut: Ich halte dieses Land für etwas Phantastisches. Das ist das beste Deutschland, das es jemals gab.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Text: F.A.Z., 05.04.2005, Nr. 78 / Seite 37
Ordnung des Landes (9): Wer soll welche Risiken tragen? Hans D. Barbier trifft Bernd Raffelhüschen zum Gespräch über die Renten, den Wohlfahrtsstaat und die Bevölkerungsentwicklung
Herr Raffelhüschen, eine ganz einfache Frage: Welche Farbe hat unsere Zukunft? Also wie dunkel oder wie hell ist unsere Zukunft, Wissensstand Anfang 2005?
RAFFELHÜSCHEN: Plakativ gesagt, die Farbe der Zukunft ist grau meliert. Das ist die dominante Stimmung, sowohl in der Bevölkerung wie auch bei den Politikern selbst. Tatsächlich haben wir ja auch einiges geschafft, also keine schwarze Zukunft, sondern eine gewissermaßen geweißte oder ins Graue spielende. Wir sind gar nicht so weit weg, zum Beispiel bei der Rente, von einem Zustand, den man nachhaltig verbessert nennen könnte.
Sie können sich eine Situation vorstellen, in der die heute Vierzig- bis Fünfundvierzigjährigen und die darunter liegenden Jahrgänge tatsächlich wieder mit einer gewissen Sicherheit, was auch ihre eigene Rente angeht, in die Zukunft blicken?
RAFFELHÜSCHEN: Ja, denn die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors ist zumindest die zweitgrößte Rentenreduktion, die es jemals in der deutschen Geschichte gegeben hat. Wir haben die Rente ja im Prinzip für die heute Dreißig- bis Vierzigjährigen um bis zu fünfzehn Prozent gekürzt. Das sind drastische Kürzungen. Wir haben bei der Rente im wesentlichen die Weichen richtig gestellt. Das heißt: Man muß länger arbeiten, und dafür bekommt man weniger Rente. Das mit der geringeren Rente haben wir geregelt, das mit der längeren Lebensarbeitszeit kommt noch.
Alle, die die alte Bundesrepublik noch kannten, haben das Gefühl, daß in der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands Phasen eines wirklichen Aufschwungs immer wieder kommen. Mittlerweile scheint es aber so zu sein, als gingen wir in eine Zukunft, in der wir aufgrund der demographischen Parameter froh sein können, wenn wir gerade noch den Status quo halten.
BARBIER: Die Vorstellung vom Aufschwung wird im wesentlichen durch zwei Phänomene gestützt. Das ist einmal der Konjunkturaufschwung. Der ist relativ kurzfristig, und man weiß auch nicht immer, woher er kommt. Er läßt einen als statistisches Ereignis eigentlich nicht im Stich, er löst aber auch keine Probleme, die mit den Institutionen der Gesellschaft zu tun haben: Eigentumsverhältnisse, Vertragsrecht, Qualität der Ausbildung, Entscheidungen für oder gegen den technischen Fortschritt. Zum anderen ist das der Wachstumsaufschwung, ein Wachstumstrend. Hier müssen wir uns die Einsicht wieder aneignen, daß Wohlstand nicht von der Verteilung kommt, sondern von der Produktion. Wenn wir mehr produzieren wollen, müssen wir mehr leisten.
RAFFELHÜSCHEN: Das, worüber wir reden, ist in der Tat ein Wachstumstrend, und dieser Trend ist in den letzten Jahren abgeflacht, und wir müssen aufpassen, daß er durch die demographische Entwicklung nicht weiter abflacht. Denn ein Alterungsprozeß in der Gesellschaft kostet Wachstumspunkte. Wahrscheinlich nicht so viele, wie die meisten Schwarzseher befürchten, aber ein wenig doch. Wir müssen uns also darüber unterhalten, wenn wir weiterhin das reichste Deutschland bleiben wollen, das wir jemals hatten.
Deutschland ist heute reicher als in den achtziger und neunziger Jahren?
RAFFELHÜSCHEN: Aber natürlich! Wir sind immer weiter gewachsen. Wir sind das reichste Deutschland, das es jemals gab. Wir haben die reichsten Rentner und die reichsten Erwerbstätigen, die es jemals gab. Nur es ist völlig richtig, daß, wenn der Trend abgeflacht ist, daß wir uns dann überlegen sollten, wie wir das Produktionspotential, das uns zur Verfügung steht, und das ist schlichtweg nur durch Arbeit sowie durch Kapital bedingt, erhöhen. Und da spielt die Arbeitszeitdiskussion eine Rolle. Wir müssen in jedem Fall die Lebensarbeitszeit erheblich verlängern. Wir werden auf siebenundsechzig Jahre beim Renteneintrittsalter gehen müssen und beim öffentlichen Dienst noch darüber hinaus.
Was man dann immer wieder hört, ist: "Länger arbeiten, das ist doch absurd, es gibt doch jetzt schon so viele Arbeitslose."
RAFFELHÜSCHEN: Man muß sich den Arbeitsmarkt ganz anders vorstellen. In den letzten zwanzig Jahren hatten wir einen Arbeitsmarkt, auf dem im Grunde genommen die Zahl derjenigen, die in ihn hineingingen, doppelt so groß war wie die Zahl derjenigen, die aus ihm austraten. In den nächsten zwanzig Jahren kehrt sich das genau um. Das heißt dann auf jeden Fall, daß sich die Lebensarbeitszeit verlängert. Hieran führt kein Weg vorbei. Die anderen Diskussionen sind Arbeitsmarktdiskussionen, die mit der Rentenversicherung nichts zu tun haben. Da geht es um die Jahresarbeitsleistung. Worüber wir reden sollten, ist eine Flexibilisierung; was wir diskutieren sollten, ist zum Beispiel, wie wir die Brückenwochenenden loswerden, wenn Feiertage auf einem Donnerstag liegen.
Nehmen wir an, es würde ein Wunder passieren, und ganz Deutschland in jedem Erwerbszweig würde auf eine Woche Urlaub verzichten. Gibt es da eine verantwortungsvolle Berechnung, was daraus folgen würde? Wenn man einfach einmal so ein Zeichen setzen würde, auch im Sinne des Aufbruchsgedankens: Verzichtet alle auf eine Woche Urlaub, dann ginge es uns besser.
BARBIER: Das klingt immer ein bißchen wie eine Reichskriegsreserve. Wir arbeiten jetzt alle einen Tag, und davon macht die Hälfte der Bevölkerung Einheitsmarmelade, die lagern wir in großen Eimern und können sie später verteilen, und die anderen machen etwas anderes. Ich glaube nicht, daß man das mit viel Sinn machen kann.
Also das ist kein Weg?
BARBIER: Noch einmal zu dem Argument "Wenn wir jetzt mehr arbeiten, dann gibt es ja wieder mehr Arbeitslose." Die Leute, die so argumentieren, denken ganz offensichtlich nur an eine ganz bestimmte Menge an ökonomisch verwertbarer Arbeit - nach dem Motto: wenn der Arbeiter A zehn Stunden mehr arbeitet, müssen die Arbeiter B und C ihre Arbeitszeit um jeweils fünf Stunden reduzieren. Aber so funktioniert eine Marktwirtschaft natürlich nicht. Angebot und Nachfrage gleichen sich nicht am Additionsstab aus, sondern über die Preise. Bei flexiblen Preisen kann es auf Dauer kein Überangebot geben. Natürlich gibt es immer auch dann immer wieder Situationen einer unfreiwilligen Arbeitslosigkeit - durch einzelne Unternehmenspleiten, durch größere Verschiebungen im internationalen Handel. Die davon Betroffenen drückt das selbstverständlich. Aber sie können sich aus dieser Situation durch Marktanpassung befreien. Gewährt man ihnen aber den vermeintlichen Schutz eines in seiner Höhe gesicherten Lohnes, dann wird möglicherweise aus einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit eine Dauerarbeitslosigkeit. Das Leben unter den Verhältnissen eines reglementierten und kartellierten Arbeitsmarktes wird nur scheinbar schöner.
Wenn es so ist, wie werden unsere Lebensläufe in der Zukunft dann aussehen? Wie wird sich zum Beispiel das Senioritätsprinzip entwickeln? Wird es weiterhin so sein, daß jemand, der älter ist, automatisch mehr verdient?
RAFFELHÜSCHEN: Die Produktivität des Menschen scheint ja ein Bergprofil zu haben. Jedenfalls stellen sich das viele so vor. Man erreicht seinen Leistungshöhepunkt Mitte bis Ende Vierzig, und dann schöpft man aus der Routine. Die Produktivität einer Arbeitskraft kommt aber sowohl aus Innovation als auch aus Routine. Das heißt auf gut deutsch, das Lohnprofil, das man sehen müßte, wäre nicht unbedingt ein nach hinten sinkendes Bergprofil, aber doch eines, das relativ flach verläuft - also in keinem Fall legitimiert es einen senioritätsbedingten Lohnanstieg am Ende der Erwerbstätigkeit. Aber wir werden uns sowieso an vieles Neue gewöhnen müssen. Wir müssen über die Arbeitszeit einer Hälfte unserer ganzen Bevölkerung diskutieren. Es kann nicht sein, daß die Frauen in dem Maße nicht erwerbstätig sind, wie sie es heute sind. Bei solchen Knappheiten von Arbeitern in der Zukunft müssen wir zu skandinavischen Arbeitsmarktbeteiligungen kommen, also dazu, daß es zwischen Männern und Frauen überhaupt keinen Unterschied in der Beteiligung am Arbeitsmarkt gibt.
Erleben wir im Augenblick eine Sozialrevolution unserer Gesellschaft in Dimensionen wie die großen sozialen Umbrüche Ende des neunzehnten Jahrhunderts?
BARBIER: Im neunzehnten Jahrhundert entstand ein neues Gesellschaftsbild durch die Technik. Es war eine neue Produktionstechnik entstanden, die einen ganz neuen Arbeitertyp, der eben massenweise in die Fabrik ging, geschaffen hat. Daraus erwuchsen hohe Produktivitätsfortschritte. Diese technische Veränderung wirkt nach, bis heute. Weit nachwirkend können natürlich auch gesellschaftliche Änderungen sein. Der heute ganz selbstverständliche Wunsch der Frauen nach Teilhabe an allen Chancen des Arbeitsmarktes gehört zu solchen Veränderungen. Das sieht man dann in den Büros, in den Statistiken zur Demographie, aber auch in den Rentenbescheiden. Wenn sich die gewohnten Muster der Sozialpolitik hieran nicht anpassen, zerbrechen sie.
RAFFELHÜSCHEN: Die Einfachheit der Rentenversicherung macht dort die Lösung einfach. Bei der Krankenversicherung ist es ganz anders. Da ist nur definiert, wer einzahlt, und schon das ist inzwischen in Frage gestellt. Die Arme, die hier in die Kasse reingreifen, sind nicht nur die der Rentner, es sind vielmehr Massen von Interessenvertretungen, und das macht die Lösung schwer. Immer dann, wenn Sie Massen von Interessenvertretungen haben, haben Sie Massen von Lobbyisten. Sie haben nicht zwei oder drei Stellschrauben, sondern eine ganze Apparatur, und die müssen Sie erst einmal verstehen und dann im Land verständlich machen, worum es geht.
Dann machen wir die Probe aufs Exempel: Nennen Sie die Vorschläge, die Sie überzeugend finden.
BARBIER: Mein Lieblingsvorschlag ist der Übergang zu einem Versicherungssystem. Versicherungen können uns helfen, Risiken kalkulierbar zu machen und sie damit - ökonomisch jedenfalls - zu bewältigen. Der Markt für Versicherungen bietet solche Sicherungen an: Einkommenssicherung für den Fall des frühen Todes oder eines schönen, langen Lebens nach der Zeit der Arbeit; Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen. Deren Leistungen sind berechenbarer als politische Zusagen der Zahlungskraft einer kollektiven Sicherung, die für allerlei Zwecke mißbraucht werden kann, die mit dem eigentlichen Versicherungsgegenstand - Alter, Gesundheit, Pflege - wenig oder gar nichts zu tun haben. Solche Versicherungspolicen werden nach dem Risiko kalkuliert. Dabei können Prämienbelastungen entstehen, die der eine oder andere nicht tragen kann oder von denen die Politik meint, daß er sie nicht allein tragen sollte. Dann bietet sich ein Weg der solidarischen Hilfe an: Wir zahlen diesen Mitbürgern einen Zuschuß aus dem allgemeinen Steueraufkommen. Das ist unter allen denkbaren Gesichtspunkten besser, als das Gebot der Solidarität zum Anlaß zu nehmen, die Beiträge "sozial" zu kalkulieren. Ehrlichkeit ist eine Tugend - das gilt auch für das Rechnen mit Risiken und Beiträgen und für die aus Steuern offen auszuweisende solidarische Hilfe.
RAFFELHÜSCHEN: Das eine ist, wie gestalte ich die Einnahmenseite in der Krankenversicherung, und das andere, wie reguliere ich die Ausgabenseite. Auf der Einnahmeseite diskutieren wir: Wie kriegen wir es hin, die Gesundheitskosten von den Löhnen zu entkoppeln? Wir können nicht all unsere Sozialleistungen von den Löhnen abzweigen. Wir haben keine Chance bei der Rente, und wir haben auch wahrscheinlich keine Chance bei der Pflege, die Lohnnebenkosten wirklich zu senken, also müssen wir den Weg über die Krankenversicherung gehen. Ihre Entkoppelung von den Löhnen ist ökonomisch sinnvoll, denn es ist nicht zu begreifen, warum man durch eine Lohnerhöhung krank werden sollte. Warum also sollte man nach einer Lohnerhöhung mehr Versicherungsprämien zahlen? Wenn man das erst einmal begriffen hat, weiß man, daß man auf der Einnahmenseite entweder auf ein individuelles Prämiensystem oder die Schweizer Lösung durch eine Kopfpauschale setzen muß. Die Bürgerversicherung hingegen verbreitert zwar die Bemessungsgrundlage, das heißt, sie nimmt Beamte und Selbständige an Bord. Damit aber nimmt sie den Sprengsatz der Beihilfe für Beamte, der jeden Länderhaushalt demnächst zur Detonation bringt, und packt ihn in eine Krankenversicherung. Die Aufnahme von Beamten wird die Krankenversicherung nur noch schneller ruinieren. Da muß man sich wirklich einfach nur die Statistik angucken, und schon weiß man, wie in etwa diese Zeitbomben ticken in den Länderhaushalten. Wenn wir zu Individualprämien oder Pauschalen kommen, dann muß man sich noch unterhalten, was gesellschaftlich zumutbar ist. Hier finde ich die ganze Diskussion schlichtweg verlogen, und zwar von allen Parteien. Alle gehen davon aus, daß der Mensch nun einmal nicht mehr als 12,5 oder 13 Prozent seines Einkommens für Gesundheit ausgeben darf. Das ist maximal zumutbar. Es ist ohne weiteres zumutbar, daß er mehr für Reisen oder für Autos oder für ähnliches ausgeben darf, aber für Gesundheit nicht. Wie auch immer man zu den Grenzen steht, eines ist in jedem Fall klar: Für Solidarität kann nicht der Beitragszahler zuständig sein. Wenn dem so wäre, wären Beamte, Reiche und Selbständige nicht mit einbezogen, und wenn sie eine Solidarität ohne diese drei Gruppen machen wollen, dann ist es eine Scheinsolidarität. Genau dies steht auf der Flagge der Bürgerversicherung. Die ist überhaupt nicht solidarisch, die ist genau das Gegenteil, es sei denn, Sie organisieren die Krankenversicherung nach englischem Vorbild, also als rein staatliches System ohne den letzten Rest von marktwirtschaftlichen Prinzipien. Wenn wir dann die Einnahmenseite solidarisch in Steuer und Äquivalenz einteilen, dann kommt eigentlich die schwerste Aufgabe. Dann kommt nämlich die Nachhaltigkeitsdiskussion, und das heißt: Wir brauchen marktwirtschaftliche Anreizmechanismen in der Ausgabenstruktur. Wir brauchen Gatekeeper, und zwar nicht den Hausarzt, der im Moment jede Überweisung schreibt, die wir haben wollen. Wir brauchen die Preisfühlbarkeit, wir brauchen das, was den Markt eigentlich ausmacht, die unsichtbare Hand der dezentralen Entscheidung.
Und wie begreift man die Preisfühlbarkeit? Indem man doch selbst dafür aufkommt beziehungsweise eine Prämie bekommt, wenn man sich entsprechend weniger untersuchen läßt und gesünder lebt?
RAFFELHÜSCHEN: Die Kunst heißt jetzt, die Anreize so zu setzen, daß die Rahmenbedingungen das Ergebnis so weit steuern, daß das Ziel auch tatsächlich erreicht wird. Wir sprechen da im stationären Bereich über ganz andere Dinge als bei ambulanter Behandlung. Die Steuerungswirkung des Preises kann ohne weiteres in weiten Teilen der ambulanten Behandlung, bei Heil- und Hilfsmitteln und auch bei Medikamenten greifen. Ich würde schlichtweg die Sachleistung in diesen Bereichen fallenlassen und auf eine Kostenerstattung übergehen. Will heißen: Jeder bekommt seine Rechnung, jeder zahlt seine Rechnung, jeder kontrolliert seine Rechnung, und keiner bekommt seine Rechnung vollständig erstattet.
Und das ist in Ihren Augen eine Möglichkeit, mit der man das Gesundheitssystem retten könnte?
RAFFELHÜSCHEN: Das ist die einzige Art, wie wir wirklich die Effizienzreserven heben, indem wir Individuen selbst entscheiden lassen, was für sie zum Beispiel Bagatellmedizin ist. Dann würde durch den Selbstbehalt - der ja hoch sein muß, und in der Schweiz ist er ja schon bei mehr als vierhundert Euro - der normale Besuch beim Arzt immer vom Individuum selbst bezahlt. Und das muß auch so sein.
Aber was heißt das denn jetzt von den Werten her? Wieviel Prozent der Bevölkerung können sich das dann leisten? Da fallen doch einige aus dem Raster.
BARBIER: In der sorgenden Formulierung, jemand falle durchs Netz, klingt etwas Schicksalhaftes an, was dann gegen die Wahl von Marktlösungen oder individuellen Entscheidungen zu sprechen scheint. Die meisten von guten Ökonomen vorgeschlagenen Reformen der Sozialeinrichtungen laufen darauf hinaus, die Kosten der Sicherung zu offenbaren. Heute werden die Kosten im unklaren gehalten. Das führt dazu, daß viele Bürger die Kosten der Vorsorge unterschätzen. Ginge man zu risikokalkulierten Prämien über, dann würde manchem klarer, daß die Vorsorge auch eine Entscheidung in der Abwägung zum Gegenwartsverbrauch ist: längere Ferienreise oder bessere Krankenversicherung - warum sollte man diese Abwägung für unzumutbar halten, da sie doch realwirtschaftlich unvermeidbar ist?
Um das genau zu verstehen: Ein Mensch der Zukunft wäre bis zu einem gewissen Grad versichert. Wenn er jetzt eine Operation hätte, vielleicht eine Herzoperation, die einhunderttausend Euro kostet, welchen Rest trägt er dann selber?
RAFFELHÜSCHEN: Es kommt drauf an. Zunächst trägt jeder im Grunde seine Rechnung selbst und zwar bis zur jährlichen Eigenbeteiligung, die in der Größenordnung von fünfhundert, sechshundert, vielleicht sogar tausend Euro liegt. Die Diskussion, die wir führen müssen, ist schlichtweg die, zu sagen: Wo ist für alle das Minimum dessen, was sie selbst tragen müssen und können? Es geht um den minimalen Selbstbehalt, den wir diskutieren. Nach oben hin können wir das freie Spiel der Marktkräfte laufen lassen. Aber das, was selbst zu leisten ist, das ist zu diskutieren. Und hier dürfen wir nicht zu niedrig ansetzen, sonst sind die Anreizwirkungen nicht ausreichend.
BARBIER: Und deshalb meinte ich, daß viele Familien in diesem Szenario ihre Urlaubspläne überdenken müßten und dazu kämen, daß es wahrscheinlich klüger ist, das Geld in ihre Gesundheit zu stecken. Aber ohne Kostenklarheit ist nicht gut rechnen - auch nicht, wenn man rechnen will.
RAFFELHÜSCHEN: Das, was wir jetzt noch diskutieren müssen, ist das reine Armutsproblem: Wenn jemand eine Prämie zahlt, und die ist schon sehr hoch, und er hat beispielsweise das Pech einer kostenintensiven chronischen Krankheit - lassen wir den allein? Also wen genau wollen wir unterstützen? Eines ist klar, wir müssen eine bestimmte Versorgung garantieren, dafür sind wir eine Gemeinschaft. Die andere Diskussion ist die fatale Neiddiskussion: Man will lieber Gleiches. Gleiches ist aber nicht immer gerecht. Es wird immer so bleiben, daß der Reiche sich mehr kaufen kann als der Arme, auch mehr Medizin. Wer dagegen angeht, unterminiert die Diskussion darüber, was die Gemeinschaft jedem zubilligt.
Aber wenn jemand die Prämie zahlen kann und hat dann eine chronische Krankheit, dann ist er doch versichert, oder nicht?
RAFFELHÜSCHEN: Nein, wenn die chronische Krankheit eine sehr teure Krankheit ist, würde er diesen Selbstbehalt von fünf-, sechs-, siebenhundert Euro im Jahr zusätzlich zu der Prämie natürlich auch nicht aufbringen müssen. Dann müssen wir ihm helfen. Aber was, wenn dieser Mann, dieser chronisch Kranke Millionär ist? Warum sollen wir als Gemeinschaft einem chronisch kranken Millionär helfen?
Der Normalfall wird aber auch hier wieder sein, daß das Bürgertum oder der Mittelstand wieder vor einer irrsinnigen Transformation steht.
RAFFELHÜSCHEN: Ja, genau hier ist das Problem. Wir haben immer Sozialpolitik betrieben, die eine Art Koalition des unteren Mittelstands mit den Armen war, und diese Koalition muß aufgebrochen werden.
BARBIER: Es zeichnet sich immer mehr ab, daß der sogenannte untere Mittelstand auch das Opfer dieser Politik geworden ist. Die sozial gemeinten Regulierungen des Arbeitsmarktes haben diesen unteren Mittelstand in die Massenarbeitslosigkeit getrieben. Ein Mitglied dieser Gruppe des unteren Mittelstandes kann durch die Fernwirkung des internationalen Handels von einem Chinesen auskonkurriert werden, er kann aber nicht in die Forschungslandschaft einer amerikanischen Hochschule auswandern. Er muß hier sein Geld verdienen, und es kann nicht sozial sein, ihn daran zu hindern.
Wenn ich mir Dreißig- oder Vierzigjährige anschaue, kann man ja jetzt schon sehen, wie sich das Konsumverhalten verändert. Das hat zu tun mit der Überlegung: Es kommen so viele Unklarheiten auf mich zu, ich werde lieber mein Geld zur Seite legen. Damit entfällt doch einer der notwendigen Parameter, die Sie auch immer lehren, daß nämlich auch Geld zum Konsum dasein muß.
RAFFELHÜSCHEN: Es ist absolut notwendig die Kapitalbildung zu forcieren. Dies schon deshalb, damit die wenigen Köpfe, die morgen dasein werden, dann so produktiv sind, daß sie das zu leisten vermögen, was wir ihnen durch die Generationenverträge alles aufbürden. Man muß sich auch klarmachen: Wir hatten Sparquoten in den sechziger und siebziger Jahren in Deutschland, die lagen etwa
bei zwölf Prozent. Wir sind auf unter
zehn Prozent gesunken. Und jetzt steigen wir wieder über zehn Prozent und
sind auf dem Wege zu elf Prozent. Wir haben noch immer nicht die Sparquote unserer Elterngeneration erreicht. Und wer dann sagt, es gibt riesige Konsumeinbrü-
Fortsetzung auf der folgenden Seite
Text: F.A.Z., 05.04.2005, Nr. 78 / Seite 36
che, der sollte sich dann mal das Konsumniveau zwischen 1960 und 1980 anschauen.
Sind wir gerade in dem richtigen Moment dabei, die Regler umzustellen, oder gibt es bereits jetzt, was das Gefühl vieler Leute ist, eine "Lost Generation", die vielleicht den Geburtsjahrgang 1960 bis 1970 hat, die die Zeche zahlen muß?
RAFFELHÜSCHEN: Hier sollte man ein wenig vorsichtiger sein. Wir haben das gleiche Problem wie alle anderen, zwar etwas stärker, aber wir sind dabei umzurudern. Die Belastungen haben wir jetzt zu verteilen, und da sind wir im wesentlichenimmer bei derselben Frage: Wer ist eigentlich der Verursacher der Probleme? Jetzt ist meine Generation dran, denn meine Generation hat immer geglaubt, sie habe ein Problem, und sie hat nicht realisiert, daß sie selbst die Ursache des Problems ist. Wenn das zutrifft, ist es zwangsläufig richtig, den Verursacher mit stärkeren Lasten zu belasten. Wir entlasten zukünftige Generationen und belasten uns, und dabei nehmen wir die Graumelierten etwas aus. Denn sie sind Motor gewesen, sie haben ihre Bringschuld geleistet, sie haben Kinder in die Welt gesetzt, Wachstum produziert und jahrzehntelang eingezahlt, und dafür werden wir sie auch in Ruhe lassen. Die aber, die wir nicht in Ruhe lassen, sind die anderen, sind die jetzigen Erwerbstätigen und die Jüngeren. Und da verteilen wir die Last relativ stark dominant in die Mitte. Bei allen Reformen, die sie gesehen haben, ob das der Nachhaltigkeitsfaktor ist, die Rente mit 67, ob das die Vorschläge in der Gesundheit oder auch die Vorschläge bei der Pflege sind, wir sind immer bei den Dreißig- bis Fünfzigjährigen, die die stärksten Lasten zu tragen haben, und das ist gerecht so. Man muß meiner Generation schlichtweg sagen, schaut in den Spiegel, ihr seht das Problem und vergeßt dabei nicht, das "mea culpa" aufzusagen.
Und die Schuld ist, keine Kinder in die Welt gesetzt zu haben?
RAFFELHÜSCHEN: So ist es. Unsere Generation hat völlig freiwillig auf Kinder verzichtet. Sie ist nie im Leben von irgend jemandem dazu gezwungen worden. Wir haben das freiwillig gemacht, und wir haben es genossen. Das hat aber seinen Preis, und den müssen wir den Leuten jetzt nennen.
Können Sie in diesen Zusammenhang einmal die Pflegeversicherung einbetten?
BARBIER: Die Einführung einer Absicherung des Pflegerisikos war gut begründbar. Die gewählte Form aber ist unentschuldbar. Sachverstand hätte dafür gesprochen, eine Pflegeversicherung nach Risikokalkulation einzuführen. Für die Anlaufjahre, also für die sogenannten pflegenahen Jahrgänge, hätte man eine ergänzende Lösung finden können: zum Beispiel einen Zuschuß zu den notwendigerweise hohen Prämien. Doch das war nicht gewollt. Es ging nach politischem Kalkül. Das Umlageverfahren verschiebt die Kosten in die Zukunft. Daß Norbert Blüm diese Zukunftsbelastung offenen Auges gewählt hat, bleibt seine Schuld. Es ist ungerecht, daß er sie nicht abzutragen hat.
RAFFELHÜSCHEN: Richtig, es ist die Wahl 1994 gewesen und das Verteilen von Wahlgeschenken. Und wieder profitierte der Mittelstand, denn der ist der große Gewinner. Es waren nicht die Armen, die durch die Pflegeversicherung bessergestellt worden sind. In Kiel kursierte schon damals immer das Wort "Erbschaftsbewahrungsprogramm", und das war es auch.
Aber stimmt es nicht, daß das "Bürgertum", also die Mittelschicht in dem Land, am meisten geblutet hat? Es gab in den achtziger und neunziger Jahren sogar die Debatte, was ein Besserverdienender ist, diese Definition hat sich immer mehr erweitert, so daß heute eigentlich ein Facharbeiter schon fast als Hochverdiener gilt. Also die Mittelschicht hat schon den Eindruck, daß die Reformen gegen sie gelaufen sind.
RAFFELHÜSCHEN: Ja, aber die Pflegeversicherung ist ein Beispiel für das Gegenteil. Man hätte niemals eine lohnbezogene Beitragskonstruktion beschließen dürfen, weil man durch eine Lohnerhöhung weder krank noch pflegebedürftig wird. Adenauer konnte noch sagen, in den letzten zehntausend Jahren war Kinderkriegen kein Problem. Aber die Blüms und die Dreßlers dieser Welt konnten das 1995 nicht. Die wußten, daß es seit dreißig Jahren den Pillenknick bereits gegeben hatte. Man wußte auch, wie teuer es war, denn man kannte die entsprechenden Ausgabenprofile. Man wußte auch, wie schnell man Sozialhilfeempfänger wird, selbst als Gutverdienender, wenn man nämlich in die Pflegebedürftigkeit kam, also war klar, daß man eine Versicherungspflicht hätte setzen müssen, es war klar, daß man etwas tun mußte, weil es ein soziales Risiko ist. Langlebigkeit bedingt Pflege. Wir hätten etwas tun müssen, aber nicht so. Die Politik ist sehenden Auges ins Messer gerannt, um etwas für einen Wahlkampf herauszuholen.
Ein anderes Thema: Gibt es aus Ihrer Sicht Gründe, die Mütter anders zu stellen in unserer Gesellschaft, ob sie jetzt verheiratet sind oder nicht? Oder ist genug getan?
RAFFELHÜSCHEN: Wir müssen nicht über Mütter, sondern über die Familie diskutieren. Der Erzieher kann nichts ohne den Ernährer, wobei der Erzieher hier erst einmal geschlechtslos ist. Ich würde es gar nicht einmal daran festmachen. Die Tatsache, daß sich zwei Menschen zusammentun und sagen, wir machen das, damit wir die Kinder stützen, um etwas weiterzugeben, das muß von der Gesellschaft honoriert werden, und ich glaube, da sind wir in unserer Gesellschaft zu lapidar. Wir sind zu kurzlebig, kümmern uns nur noch um die nächsten zwei, drei Tage. Da ist die Gemeinschaft eben sehr schnell dabei zu sagen, Familie sei Privatsache. Das ist sie nicht. Familie ist etwas Gesellschaftliches. Und aus diesem Nukleus wächst sehr viel Stabilität, sehr viel Zukunft. Zukunft ohne Familie ist gar nicht da.
BARBIER: Man soll eine Gesellschaft als Ganze nicht personalisieren. Aber eigentlich liegt doch der Gedanke nicht fern, eine Gesellschaft habe das Recht, sich das demographische Bild zu geben, das sie hat und mit dem sie in ihre eigene Zukunft geht. Natürlich kann man über allerlei Einrichtungen nachdenken, die das Kinderkriegen und die Berufstätigkeit miteinander verträglicher machen. Aber es haftet doch viel Illiberales an Aufrufen und Anrufungen, es müsse wieder eine Mentalität des Kinderkriegens her.
Gibt es denn Modelle, wie man Anreize schaffen kann in einem Wirtschaftssystem, daß man sagt, jetzt werden sich viel mehr bereit erklären, Kinder zu haben?
BARBIER: Für mich wirken die Vorschläge, die man am meisten hört, doch ziemlich ausgedacht und im Licht der Praxis eigentlich nicht so sehr überzeugend. Bleiben wir einmal bei dem naheliegenden Fall der Kinderbetreuung im Unternehmen. Da hat man offenbar das Bild der jungen Frau, die morgens mit einem oder zwei Kindern ankommt. Die Kinder sind gesund und spielen unter der Aufsicht einer Dame aus der Sozialabteilung. Was aber ist, wenn die Kinder Windpocken haben? Was tut dann die junge Bankangestellte, die, wir sind hier in Frankfurt, eigentlich eine Tageskonferenz der Europäischen Zentralbank beobachten sollte und wollte? Wie viele Windpockenattacken übersteht die Dame in der Frühphase ihrer Karriere? Solche Fragen müssen nicht das letzte Wort zu allerlei gutgemeinten Vorschlägen sein. Aber die Vorschläge müssen sich doch auf Gebrauchstüchtigkeit testen lassen.
Zum Abschluß noch eine Frage, Herr Raffelhüschen: Sie als Professor, als einer, der ja auch mit jungen Leuten zu tun hat, bemerken Sie auch in Ihrem Gebiet Abwanderungsgedanken bei guten Nachwuchskräften? Oder ist das kein großes Thema?
RAFFELHÜSCHEN: Bei uns am Institut haben wir schon immer die Kontakte mit den Vereinigten Staaten gepflegt. Ich bin selbst eine "Rückholaktion". Wir sind aber auch mit Skandinavien verzahnt durch meine Professur in Norwegen. Also bei uns ist es immer so, daß es nicht Abwanderung ist, sondern man geht immer für eine gewisse Zeit und kommt wieder.
Aber müssen wir nicht damit rechnen, daß die guten, hochqualifizierten Leute nach Amerika oder sonstwohin abwandern?
RAFFELHÜSCHEN: Es gehen immer Hochqualifizierte nach Amerika. Gott sei Dank kommen auch immer einige zurück. Ich glaube, wenn das letztere nicht mehr passiert, dann haben wir ein Problem. Wir haben drei, vier gute Köpfe wieder zurückgeholt in den letzten Jahren in den Wirtschaftswissenschaften, und wir werden das hoffentlich weiter schaffen. Das kann sich ändern. Aber, wie gesagt, erst dann, wenn sich das ändert, dann werden wir ein Problem haben.
Wenn Sie aus dem Bewußtsein heraus, welches Sie im Augenblick haben, und dem Kenntnisstand über demographische, wirtschaftliche, ökonomische Parameter der Länder dieser Erde entscheiden müßten, in welchem Land, das uns umgibt, würden Sie denn gerne wohnen?
RAFFELHÜSCHEN: Die Antwort meines Herzens ist ganz schlichtweg: Ich lebe am liebsten hier. Das ist ein Land, in dem meine Kinder groß werden, in dem meine Eltern groß geworden sind, das sie aufgebaut haben. Ich habe keine Probleme mit diesem Land. Ich gehe aber auch immer mal wieder gern raus, und ich glaube, dieses Land begreift man auch erst mit dem Blick von außen. Man begreift oft auch erst, wie gut es eigentlich dasteht, wenn man sich das von außen angeschaut hat.
Wenn man aus Amerika oder aus Skandinavien auf uns schaut?
RAFFELHÜSCHEN: Auch wenn man aus Skandinavien auf uns schaut, und das habe ich oft getan, und auch wenn man aus Amerika auf uns schaut: Ich halte dieses Land für etwas Phantastisches. Das ist das beste Deutschland, das es jemals gab.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Text: F.A.Z., 05.04.2005, Nr. 78 / Seite 37
... link
... comment